Warum eine Archivarin sich nicht mit Sachbearbeitung, sondern mit den Schicksalen von Menschen beschäftigt, was sie als eine Niederlage empfindet und was ein steinerner Gast damit zu tun hat.

Wie ich zu Memorial kam? Eines Tages sagte mir meine Freundin, Kollegin und Weggefährtin Aljona: „Bei uns gibt es eine Möglichkeit, eine offene Stelle, um bei der Vervollständigung der Sammlung mitzumachen. Wir haben gerade eine Anfrage: Jemand möchte, dass wir vorbeikommen und sein Archiv mitnehmen. Dabei musst du aber wissen, dass du diese Person das erste und letzte Mal im Leben sehen wirst. Du fährst hin, nimmst alles und gehst dann wieder…“
Diese „Person“ wurde dann für den Rest meines Lebens meine engste Freundin. Ich habe sie später zu Grabe getragen. Ich bin nämlich tatsächlich da hingefahren und sie gab mir ein riesiges Archiv. Sie ging raus, um Tee zu machen, und auf dem Nachttischchen lag ein aufgeschlagenes Buch. Ist ja immer spannend, was jemand so liest. Es war ja nicht so, dass ich schlechte Manieren an den Tag legte… Ich gehe also zum Tischchen, schaue mir die aufgeschlagene Seite an, sehe ein Gruppenfoto — und entdecke dort meinen Vater. Das Buch war aus Anlass des 50. Jahrestags des Instituts erschienen, an dem mein Vater gearbeitet hatte, und an dem auch der Mann unserer Informantin arbeitete. Das war für mich ein Zeichen, dass es wohl einen Sinn hat, ein wenig bei Memorial zu arbeiten. Wovon ich mich dann viele Jahre lang vielfach überzeugen konnte.
Ich bin eher zufällig Archivarin geworden. Ich bin durch Zufall dort hineingeraten und habe dann verstanden, dass das eine einzigartige Welt aus Zauber und Märchen ist. Weil sich einem hier plötzlich ganz ungeahnte Dinge eröffnen können.
Ein gewöhnlicher Archivar sitzt am Tisch, vor ihm Stapel aus Papieren, die er durchnummeriert und in Kartons legt, und die beschriftet er dann. Schlag fünf geht er nach Hause.
Das Archiv von Memorial ist ein wenig anders. Ich weiß nicht, warum. Hat sich wohl historisch so ergeben. Aber vielleicht sind wir einfach der Ansicht, dass wir nicht Sachbearbeitung betreiben, sondern Schicksale von Menschen in den Händen halten.
Da habe ich jetzt wohl aus Zufall etwas Wichtiges gesagt. Wahrscheinlich, weil es die Wahrheit ist: Wenn wir einen Satz Dokumente in die Hände bekommen, ist uns klar, dass dahinter ein Mensch steht. Weiter kannst du vorgehen, wie du möchtest. Du kannst [die Papiere] in einen Umschlag stecken und vergessen. Oder du kannst versuchen, dir klar zu machen, dass man eine Fortsetzung dazu finden könnte. Aber was soll es da für eine Fortsetzung geben, wenn wir von der Vergangenheit sprechen? Trotzdem...
Einmal geriet völlig zufällig ein Archiv zu uns, das eine Menge Dokumente umfasste, es wurde als ein eigenes Thema ausgegliedert. Das waren Briefe eines Häftlings aus der Zeit vor der Revolution. Er saß unter dem Zaren im Gefängnis, und es waren seine Briefe aus dem Zuchthaus (wenn wir schon in der vorrevolutionären Zeit sind, soll auch die Lexik passen). Er schreibt seiner Frau Briefe. Seine Haftbedingungen sind hart: Einzelzelle, wenn ich mich recht erinnere, mit einer sehr kleinen Fensteröffnung. Und durch diese Öffnung verfolgt er die Veränderungen in der Natur: dass Schnee liegt oder im Gegenteil, dass eine Blume blüht. Er schreibt sogar Gedichte darüber und schickt sie seiner Frau.
Sein Nachname ist nicht der allerhäufigste, und ich wurde neugierig, was weiter mit ihm geschehen war. Nach kurzer Suche fand ich heraus, dass dieser Mensch… Dieser Revolutionär Revolutionärowitsch – nennen wir ihn einfach so, all seines Pathos wegen – steht für das Glück des Volkes und den Sieg über den verfluchten Zarismus: Es wird eine glückliche Gesellschaft geben, wir werden sie mit unseren Händen errichten! Nun, er wurde 1937 erschossen, keine Überraschung.
Die Revolution hat ihn aus der Haft befreit, er ist glühender Anhänger Lenins. Er machte nicht schlecht Karriere, wurde aber 1937 erschossen. Ich konnte unschwer herausfinden, dass er erschossen wurde: Wir haben eine Datenbank, dort schaute ich nach, ohne vom Stuhl aufstehen zu müssen. Dann versuchte ich herauszufinden, ob es jemanden mit entsprechendem Patronym und Nachnamen gibt.
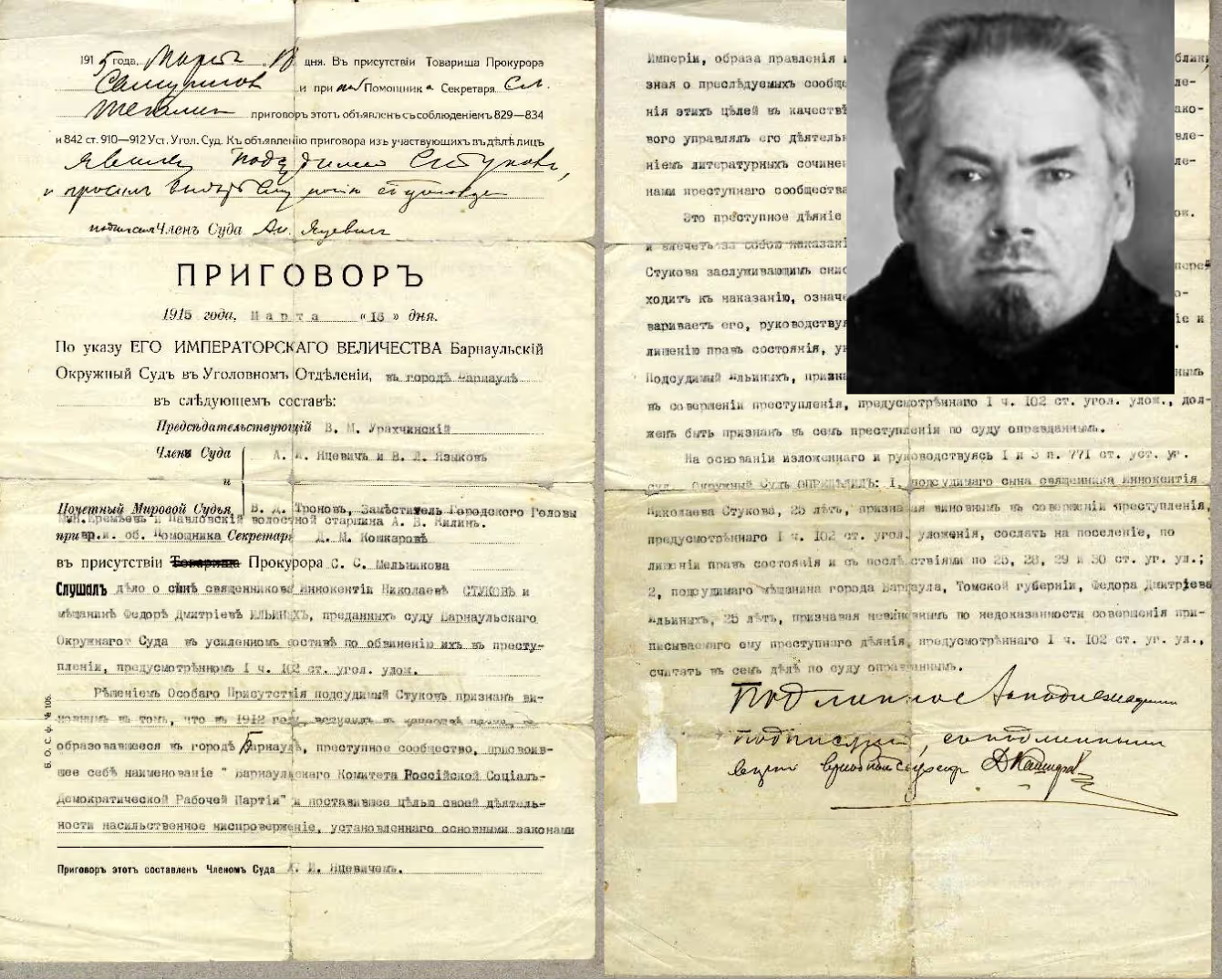
Einmal geriet völlig zufällig ein Archiv zu uns, das eine Menge Dokumente umfasste, es wurde als ein eigenes Thema ausgegliedert. Das waren Briefe eines Häftlings aus der Zeit vor der Revolution. Er saß unter dem Zaren im Gefängnis, und es waren seine Briefe aus dem Zuchthaus (wenn wir schon in der vorrevolutionären Zeit sind, soll auch die Lexik passen). Er schreibt seiner Frau Briefe. Seine Haftbedingungen sind hart: Einzelzelle, wenn ich mich recht erinnere, mit einer sehr kleinen Fensteröffnung. Und durch diese Öffnung verfolgt er die Veränderungen in der Natur: dass Schnee liegt oder im Gegenteil, dass eine Blume blüht. Er schreibt sogar Gedichte darüber und schickt sie seiner Frau.
Sein Nachname ist nicht der allerhäufigste, und ich wurde neugierig, was weiter mit ihm geschehen war. Nach kurzer Suche fand ich heraus, dass dieser Mensch… Dieser Revolutionär Revolutionärowitsch — nennen wir ihn einfach so, all seines Pathos wegen — steht für das Glück des Volkes und den Sieg über den verfluchten Zarismus: Es wird eine glückliche Gesellschaft geben, wir werden sie mit unseren Händen errichten! Nun, er wurde 1937 erschossen, keine Überraschung.
Die Revolution hat ihn aus der Haft befreit, er ist glühender Anhänger Lenins. Er machte nicht schlecht Karriere, wurde aber 1937 erschossen. Ich konnte unschwer herausfinden, dass er erschossen wurde: Wir haben eine Datenbank, dort schaute ich nach, ohne vom Stuhl aufstehen zu müssen. Dann versuchte ich herauszufinden, ob es jemanden mit entsprechendem Patronym und Nachnamen gibt.
Darum hatte mich niemand gebeten, um ehrlich zu sein. Es war einfach der Wunsch, die Fortsetzung [dieser Geschichte] zu erfahren. Damit wir wissen, was weiter geschah. Sein letzter Brief war von 1916, und wir wissen von der Hinrichtung des Mannes 1937. Mehr nicht, das war’s. Ist doch irgendwie lasch, oder?
Nun, wir fanden seinen Sohn, der nicht mehr am Leben war, und seine Enkelin. Der schrieb ich auf Facebook. Es sind ja viele Leute auf Facebook, die schreibst Du dann im Chat an. Nach einiger Zeit antwortete sie. Ich sagte ihr, dass wir Briefe ihres Großvaters haben, und ob sie die lesen wolle? Sie kam sofort zu uns.
Ich erinnere mich, dass sie außerhalb der Stadt lebte und arbeitete. Und dass sie fragte „Geht’s auch am Wochenende? Unter der Woche kann ich nämlich nicht.“ In so einem Fall ging das natürlich. Wir saßen dann zu zweit [im Büro], sonst war niemand da.
Sie las die Briefe mit einer gewissen Erschütterung. Und sie sagte diesen sehr beeindruckenden Satz: Ihr Großvater habe sich hier natürlich von einer ganz unerwarteten Seite gezeigt. Für ihren Vater war dessen Vater ja — wie das bei uns so üblich ist — der große glänzende Ritter der Revolution, der auf den Barrikaden umkam. Erschossen, rehabilitiert. Deswegen so ein… Held. Wie ein schweigender, steinerner Gast. Sie sagte: „Hören Sie, er schreibt ja Gedichte, er ist ja lebendig. Denn er weint hier…“ Ein steinerner Gast weint nie und nimmer.
Also haben wir ihr dadurch einen lebendigen Menschen geschenkt. Ist das Archivarbeit oder nicht? Braucht das jemand? Außer dieser einen Frau und uns, den Mitarbeiterinnen von Memorial, die diese Verbindung gezogen und einander unbekannte Menschen zusammengebracht haben, die allerdings immerhin den Nachnamen teilen. Bedeutet das Glück für sie, Erleichterung, oder haben wir ihr, im Gegenteil, eine Last aufgebürdet? Oder was sonst haben wir dadurch getan?
Jetzt möchte ich von einem anderen Beispiel erzählen, das auch absolut extrem ist. Es war für mich aber, das will ich gleich sagen, eine Niederlage. Es begann, wie immer, mit einem Zufall. Solche Zufälle passieren tagtäglich, sind aber trotzdem Zufälligkeiten… In einem ganz anderen Archiv gab es einen eigenartigen Teil, der für mich sehr interessant war, weil das Material nicht in unsere Zeit fiel. Wir sind nämlich der Ansicht, dass die Ära, zu der wir arbeiten sollten, von 1917 bis 1991 reicht. Und hier ging’s um den Ersten Weltkrieg.
Eine Frau, eine Krankenschwester schreibt ihrer Cousine Briefe. Und macht damit weiter, schreibt bis in die 1960er Jahre Briefe an diese Cousine. Wir erfahren aus diesem umfangreichen Briefwechsel, dass sie zuerst Krankenschwester, barmherzige Schwester im Ersten Weltkrieg war. Und dass auch ihr Vater im Ersten Weltkrieg kämpfte.
Ich verstehe und kombiniere, dass es sich um den großen General Tumanow handelt, einen georgischen Fürsten. Die Fotos sind von einmaliger Schönheit. Fotos aus der Zeit vor der Revolution, auf Kartonpapier; auf der Rückseite steht geschrieben, dass alle Negative aufbewahrt werden. Das muss Sammlerinnen und Archivarinnen (die ja auch Sammlerinnen sind) einfach in Begeisterung versetzen. Aber es geht eben nicht um „unsere“ Zeit, sondern um den Ersten Weltkrieg und um einen Menschen, der kein Opfer war.
Mit einiger Willensanstrengung finde ich einen Enkel, auf lustige Weise, weil [dem Archiv] ein Notizbüchlein mit Telefonnummern aus den 1970er und 80er Jahren beigefügt war. Ich rief die Nummer an und er ging ran. Ich sagte zu ihm: „Wissen Sie, wir haben Fotos Ihrer Großmutter.“
Aus den Briefen wusste ich auch, dass unsere Heldin Tamara Tumanowa einen Sohn hat, der von seiner Frau geschieden ist, dass es also einen Sohn und einen Enkel gibt. Sie ist sehr einsam, lebt in Tbilissi und leitet dort den Lehrstuhl für Klavier am Konservatorium. Sie hat niemanden außer ihrem Sohn und ihrem Enkel in Moskau; dessen Eltern sind geschieden. Ihren Jungen sieht sie nicht und leidet darunter. Sie ist sehr beunruhigt, dass sie im Alter so einsam ist und keine Möglichkeit hat, mit dem einzigen und geliebten Enkel zu sprechen. Ich rufe also den Enkel an und sage: „Wissen Sie, wir haben Fotos von Ihrer Großmutter. Sie können vorbeikommen.“ Er sagt: „Das interessiert mich nicht.“
Ich wartete einige Zeit und versuchte, mir selbst eine schöne Geschichte als Begründung auszudenken, nach dem Motto: Ich hatte einen wohl nicht mehr jungen Menschen angerufen und eine Menge Informationen über ihm ausgeschüttet. Alle haben jetzt Angst vor Betrügern, vor Gaunern. Er denkt wahrscheinlich, dass ich etwas von ihm will. Vielleicht habe ich ungeschickt geredet. Vielleicht hat er es so verstanden, dass ich ihn besuchen will, und hat einen Schreck bekommen, will niemanden zu sich lassen.
Ein, zwei Monate später rufe ich nochmal an und sage: „Wir hatten vor einiger Zeit miteinander gesprochen. Wir haben Fotos von Ihrer Großmutter, die haben wir eingescannt. Wenn Sie mir Ihre Adresse sagen, schicke ich sie Ihnen.“ Er sagt: „Das interessiert mich nicht.“
Ein solcher Fall ist mir nur einmal untergekommen, aber ich nahm ihn mir sehr zu Herzen… Ich stellte mir vor: Wenn mich jetzt jemand anrufen würde und sagen: „Ich habe Fotos Ihrer Großmutter…“ Mein Gott, ich würde da zu Fuß hinlaufen, barfuß.
Vor recht langer Zeit war eine Mitarbeiterin [von uns] in Kolyma [einer Region im Norden Sibiriens, in der sich Lager des GULAG mit äußerst harten Lebensbedingungen befanden]. Als sie zurückfuhr, brachte man ihr an den Dampfer… oder was gibt es da jetzt, Dampfer, Motorschiffe? Also, was auch immer da in Kolyma fuhr… sie kamen also und sagten: „Wissen Sie, das haben wir gefunden“ und gaben ihr ein Päckchen Briefe. Lagerbriefe.
Die Frau war auf eine Expedition nach Kolyma gefahren. Unsere Mitarbeiter fuhren in den 1990er Jahren viel dorthin, auf Exkursionen: verlassene Lager, Archivarbeit, alles Mögliche. Sie bekam also das Päckchen Briefe, wir schauten sie durch, studierten sie, und es stellte sich heraus: Es ging um Bodrow, einen sehr bekannten Trotzkisten. Der war mehrmals verhaftet worden, Opfer der Repressionen. Ein unglaublicher Marathonhäftling. Er war ein überzeugter Trotzkist: Als Trotzki in Kasachstan in der Verbannung gelandet war, fuhr er hinterher, ließ sich einen Bart wachsen, damit er wie ein Kutscher, ein Fuhrmann daherkam. Dadurch konnte er mit Trotzki in Verbindung bleiben.
Es gab einige Postkarten an seine Kinder, die er aus der Haft in Kolyma schrieb. Wie ging das normalerweise vor sich? Er schreibt einen Brief und wirft ihn in den Kasten. Dann schaltet sich die Zensur ein, weil es ja Lagerpost ist. Mal schicken sie es weiter, mal landet es in seiner Akte. Und jetzt hatten wir das, was in der Akte gelandet war.

Damals, in den 1990er Jahren wurden nämlich in Kolyma die Archive der Behörden aufgeräumt. Und was den Leuten damals unnütz erschien, wurde einfach weggeworfen. Jemand hatte das aufgesammelt und aufgehoben, und dann kam unsere Irina, der es übergeben wurde. Und so blieb es erhalten!
Dann sitzen wir wie gewohnt und arbeiten. Das Telefon klingelt, nicht ich nehme den Hörer ab, sondern eine Kollegin. Sie redet ziemlich aufgeregt, legt auf und sagt: „Hör mal, das war Bodrows Enkelin aus Paris.“ Ich sage: „Wie, Bodrows Enkelin?“ — „Nun ja, Bodrows Enkelin.“ — „Ja“, sage ich, „und weiter? — „Ich hatte ihr gesagt, dass wir Briefe ihres Großvaters haben. Sie sagte: Ich nehme das Flugzeug.“ Sie kam tatsächlich nach Moskau geflogen.
Das Interessanteste ist: In der Familie wusste niemand, dass er ein Trotzkist war. Seine Frau hatte nämlich die Geschichte verbreitet, er sei ein echter Kommunist gewesen, ein Bolschewik. Keinerlei Konflikte mit der Parteilinie. Nun, und er sei gestorben, wie jeder mal stirbt. Und jetzt, wie vom Himmel gefallen, diese Wendung seiner Geschichte…
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Was sich in einem alten Kissen verbergen kann, wie Ermittlungsakten zu lesen sind und warum das Erstellen von Archivkarteien die Geschichte der Sowjetunion umkrempelt.

„Das Einzige, was ich Ihnen anbieten kann, ist unablässige, schwere Arbeit. Kärtchen schreiben. Weil sich hinter jedem Kärtchen für uns ein Mensch verbirgt.“
Arseni Roginski [Historiker und Menschenrechtler, Mitgründer der Gesellschaft Memorial] hat einmal – außer, dass er uns auftrug, Kärtchen zu schreiben – die Formulierung geprägt (eine bemerkenswerte, wie ich finde), dass wir die gesamte Geschichte der Sowjetunion umkrempeln. Dass wir diese Pyramide von den Füßen auf den Kopf stellen.
Wir setzen es zusammen: das erste Schicksal, das zweite, das zehnte, das zwanzigste… Und dadurch erhalten wir die Geschichte des Landes. Und des Krieges, der Siege und der Repressionen. Geschichte kann nicht nur wunderbar sein, nur ruhmreich, nur siegreich. Sie ist so, wie sie ist.
Daher haben wir, als das Archiv von Memorial gesammelt wurde, lange darüber nachgedacht, worauf wir uns konzentrieren sollen, welche Ausrichtung das Archiv haben sollte. Und haben dann beschlossen, nicht Unterlagen aus den FSB-Archiven zu sammeln, sondern alles, was in der Erinnerung der Menschen geblieben ist. Alles, was aus den Familien kommt, was es in den Wohnungen gibt. Manchmal ein ganzer Koffer, und manchmal nur ein Fetzen Papier.
Und wenn wir diesem einen Fetzen eine Ermittlungsakte zuordnen können, dann erhalten wir beide Seiten der Medaille. Weil wir, wenn wir die Ermittlungsakte nehmen und lesen… Es ist tatsächlich viel Arbeit, eine Ermittlungsakte zu lesen. Man muss sich in jeder Minute bewusst sein, dass sie aus der Hand eines Ermittlers stammt. Und der Mensch [den die Akte betrifft] tritt nur sehr schemenhaft aus den Aufzeichnungen des Ermittlers hervor. Das muss man stets im Kopf behalten, und das ist schwierig, weil praktisch unter jedem Absatz eine Unterschrift steht. Er [der Beschuldigte] unterschrieb, unterschrieb, unterschrieb. Ein Geständnis. Warum hat jemand gestanden? Wozu? Das alles sehen wir ja nicht.
Es ist immer wieder Thema großer Forschungsarbeiten: die Kultur des Protokolls, die Sprache des Protokolls… Wir können aber auch manchmal sehen, dass ein Verhör, sagen wir, um 19.15 Uhr begann und um 2.30 Uhr endete. Hat es wirklich so lange gedauert? Sieben Stunden... und nur drei Seiten [Protokoll]. Was ist in den sieben Stunden passiert, die auf drei Seiten landeten [– oder eben auch nicht]?
Oder wir lesen einen Absatz, der sinngemäß sagt: „An Freitagen organisierten wir Zusammenkünfte und planten einen Terroranschlag gegen die Parteiführung und die Regierung.“ Was bedeutet das? Dass sich Männer freitags nach der Arbeit trafen und Bier tranken. Verstehen Sie? Der Ermittler kann das aber nicht schreiben, er muss alles in Richtung einer Verurteilung lenken. Was ich gerade sagte, ist konstruiert, in Wirklichkeit gab es gab diesen Fall so nicht. Sie sehen also ein Verhörprotokoll, in dieser verqueren Sprache, in der es vielleicht nicht „Treffen“, sondern „Zusammenkünfte“ heißt, und nicht „Gruppe von Freunden“, sondern „Clique“ oder „Bande“.
Manchmal ist das die einzige Quelle. Die einzige, eine andere gibt es nicht. Wenn wir mit diesem Dokument irgendetwas in Verbindung bringen können, was der Betreffende selbst geschrieben hat, einen Brief, einen Antrag, mal angenommen, sogar an höhere Stellen, einen Antrag auf Revision oder Begnadigung, wo beschrieben wird, was geschah, dann ist das ein Riesengewinn.
Jeder Schnipsel hat einen riesigen Wert, jedes Papierchen. Es muss nicht mal ein Brief aus dem Lager sein oder ein Ausschnitt davon. Das ist ein sehr seltener Fall und hat sehr großen Wert. Und es ist recht selten, unglaublich selten. Dass wir eine derart große Sammlung haben, liegt daran, dass wir dreißig Jahre lang jedes Körnchen, jedes Steinchen, jedes Detail gesammelt haben.
Wir haben also eine ganz andere Blickrichtung, eine andere Haltung zu den Dokumenten. Daher stammt wohl auch meine Einstellung zu jedem dieser Papiere, wie zu einem persönlichen Erbe. Und daher diese meine aufgeregte Haltung zum Protagonisten, zum Helden [der Unterlagen]. Er wird zu einem Helden, verstehen Sie? Sie sind übrigens allesamt meine Lieblingshelden, ich kenne sie alle.
Einmal kam jemand, ungefähr in meinem Alter. Das war vor zehn Jahren. Vielleicht war er etwas jünger als ich. Er sagte, seine Mutter sei gestorben. Die hatte ein Lieblingskissen, von dem sie sich nie trennte. „Ihre Mutter ist gestorben, was haben Sie als erstes gemacht?“ Er hat das Kissen geöffnet. Und da waren Fetzen drin, die man fast schon nicht mehr Fetzen nennen konnte… Er brachte ein Häufchen davon mit: uralte Papierschnipsel mit Kissendaunen dazwischen.
Es gibt Dokumente, Bescheinigungen, die… Wissen Sie, [es ist] wie bei Sherlock Holmes, der eine bestimmte Titelseite der Times anhand einer einzigen Zeile identifizieren konnte. Auch ich konnte anhand eines Buchstabens eine Entlassungsbescheinigung erkennen. Die ist sehr charakteristisch, die verwechselt man nicht. Ich sage der Person, die mit den Fetzen kam: „Das ist eine Entlassungsbescheinigung.“

Aber dann folgt eine sehr merkwürdige Geschichte. Er sagte nämlich: „Meine Mutter hat nie gesessen.“ Seine Mutter hatte nie [im Gefängnis] gesessen, aber er kam dennoch zu Memorial. Verstehen Sie? Wir werden hier niemandem solche Ungereimtheiten vorhalten. Er ist ja zu Memorial gekommen. Er wusste, wohin er ging. Und dennoch: „Mama hat nie gesessen.“
Natürlich hatte seine Mutter gesessen. Die Sache war die, dass er nach ihrer Freilassung geboren wurde, und sie hat ihm nie etwas erzählt. Diese Seite ihres Lebens, diese ganze Schicht war für ihn absolut unangetastet geblieben. In so einem Fall reagieren die Menschen dann ganz unterschiedlich. Er kam nie mehr wieder.
Und es gibt ein völlig geniales Beispiel. Da kam jemand mit einem in der Literaturwelt sehr bekannten Namen. Er wollte seinen Großvater suchen. Den Großvater zu finden, war kein Kunststück, der war erschossen worden, weswegen wir ihn augenblicklich [in der Datenbank] aufspürten. Und es gibt Großväter, bei denen klar wird, wenn man genauer hinschaut, dass da auch die Großmutter nicht weit sein kann. Deshalb fragten wir: „Und Ihre Großmutter?“. Er sagt: „Ich weiß nicht, weiß nicht einmal, wie sie hieß.“ — „Sie kennen ihren Namen nicht, aber wir kennen ihn. Wir können Ihnen erzählen, wie sie hieß und was mit ihr geschah.“
Der Mann verließ uns [nachdem er die Geschichte seiner Großmutter gehört hatte], als ob er Pudding in den Beinen hätte. Es verging einige Zeit, dann kam er kurz vor Silvester zu uns ins Archiv und hatte einen Korb dabei. Einen Neujahrskorb mit allem, was dazu gehört! Nun, sehr gut. Ein Jahr verging, und er kam erneut mit einem Korb. Ein weiteres Jahr verging, und er brachte wieder einen Korb vorbei. Das erste Mal war das 2017. Und stellen Sie sich vor: Er kam am 29. Dezember 2023 vorbei, brachte einen Korb und sagte, er werde immer wieder kommen.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Eine einzigartige Sammlung von Briefwechseln zwischen Kindern und ihren inhaftierten Vätern. In fast keinem Fall war ihnen ein Wiedersehen beschieden.

Es gab da diesen Moment, da erhielten eine Kollegin und ich einige Sammlungen, die aus unserer Sicht völlig einzigartig waren: Briefe von Vätern, geschrieben aus dem Lager.
Als der Papa noch zu Hause war… Er kam immer spät nach Hause, sah sein Kind nur, wenn es schon schlief, oder wenn es noch schlief. Er liebt es zweifellos, denkt zweifellos: Wenn es Sonntag ist, dann gehe ich mit ihm in den Zoo oder lese ein Buch vor.
Aber dann wird Papa verhaftet.
Von diesen sechzehn Menschen hat kaum einer überlebt. Ich glaube, nur drei sind wieder freigekommen. Alle anderen starben entweder im Lager oder wurden nach einem zweiten Urteil erschossen. Aber dieser absolut mächtige Instinkt eines Vaters, der kommt unter Lagerbedingungen fast schon fanatisch zum Durchbruch. Sie schreiben ihren Kindern nicht einfach nur Briefe, in denen steht: „Hör auf Mama, pass gut in der Schule auf und geh’ an der frischen Luft spazieren.“ Sie geben ihnen in den Briefen etwas mit – das war wie Fernunterricht, quasi online, wie während der Corona-Pandemie. Sie geben [ihren Kindern] etwas mit, das ihnen wichtig, das für sie wertvoll ist.
Es sind ganz verschiedene Leute, und es gibt daher ganz unterschiedliche Geleitworte und Unterrichtungen. Einer unserer Protagonisten war leidenschaftlicher Briefmarkensammler. Und er zeichnete für seinen Sohn, auch als er aus dem Lager schrieb, mit der Hand Briefmarken auf die Briefe. Dabei hatten diese Briefmarken einen ganz aktuellen Sinn: Er zeichnete das, was ihn umgab. Er saß in Gornaja Schorija, im Siblag [sibirische Verwaltung für Straflager], und er zeichnete ein Bild des Lagers als Briefmarke. Das ist wirklich beeindruckend. Das Interessanteste ist, dass sein Sohn später gar nicht anders konnte: Er wurde auch Briefmarkensammler. Wie könnte es anders sein?
Dann gab es da so einen ganz faszinierenden Menschen. Überhaupt sind sie natürlich alle genial. Der aber war völlig genial. Alexej Wangengejm, der in der Sowjetunion den Wetterdienst begründet hat. Er schreibt seiner Tochter [aus der Haft] wunderbare Briefe, die Bildung und Aufklärung vermitteln. Das Kind wächst heran… Als er 1934 verhaftet wurde, war die Tochter vier; bis 1937 schrieb er ihr Briefe. Anfangs waren es Kinderrätsel, dann alle möglichen Naturphänomene, eine Sonnenfinsternis, mathematische Spiralen, Perspektiven… Und das alles in Zeichnungen.

Dann erfand er eine Wissenschaft, ich weiß nicht, wie die heißt, botanische Arithmetik oder arithmetische Botanik… Er sammelte ein Herbarium… Das alles fand auf den Solowezki-Inseln statt. Dazu muss man wissen, dass der Sommer auf diesen Inseln nur etwa anderthalb Monate dauert. Er sammelte Kräuter, um ihr von Brief zu Brief etwas zu zeigen und zu erklären. Nummer eins: ein Blättchen, und alles, was es dazu geben könnte; Nummer zwei: Doppelnadeln einer Kiefer und alles drumherum; absolut bemerkenswert. Dieses Herbarium ist erhalten geblieben und wurde unserem Archiv übergeben.

Jeder dieser Väter vermittelt seinen Kindern in den Briefen auf diese Art, aus der Ferne, das, was ihm wichtig erscheint. Wir beschlossen, diese Schicksale zu sammeln und davon zu berichten, und auch davon, wie sich das Schicksal ihrer Kinder weiter entwickelte. Wenn der Sohn eines Briefmarkensammlers selbst Philatelist wird, was könnte dann aus der Tochter eines Meteorologen werden? Sie wurde Paläontologin, wurde zur wichtigsten Mammutforscherin der Sowjetunion. Bei ihr zu Hause lagen Mammutstoßzähne, einfach so, auf dem Boden. Ich war bei ihr zu Hause.
Ich kenne diese Menschen. Sie sind in mein Leben gekommen, sind Teil meines Lebens geworden. Das wäre wohl, ich weiß nicht, für jeden anderen Menschen ein etwas unnatürlicher Zustand. Andererseits treten ja die Protagonisten aus Büchern, aus der Literatur auch in unser Leben; sie werden auch zu unseren Freunden, unseren Protagonisten, gehören zu unseren Sujets. Wir beraten uns mit ihnen, wenn nötig, oder stellen uns in eine Reihe mit ihnen, orientieren uns an ihnen. Das gibt es ja auch.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Wie ein Archiv einem nicht nur etwas über sich selbst erzählen, sondern das eigene Leben verändern kann.

Was meinen Sie: Wenn wir auf die Straße gehen und dort hundert Leute zusammenholen, wie viele davon sind jemals in ihrem Leben in einem Archiv gewesen? Oder haben sich an ein Archiv gewandt? Ich glaube, keiner.
Denn was ist das, ein Archiv, in unserem Alltagsverständnis? Das ist so eine unklare Sache. Dort liegen wahrscheinlich Haufen alter Papiere rum. Was könnte es da geben? Was suchen wir da, wozu gehen wir da hin und wie kommen wir dort hin? Und: Können wir überhaupt dort hingehen?
Wenn es um unser Thema geht, die Repressionen, was heißt das dann? Zum KGB [heute: FSB] gehen? Auf eigenen Beinen, gerade dort hin, dort hinein? „Was fällt Ihnen ein? Warum sollte ich da hin? Ich habe Angst. Womöglich werden sie von mir irgendwelche Verpflichtungen fordern, irgendwelche Unterschriften. Und wenn sie mich zwingen, so ein Mitarbeiter zu werden? Ich will nicht, ich habe Angst, ich geh’ da nicht hin.“ Da kommt sofort eine riesige Menge solcher Emotionen hoch.
Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Ich war sehr oft im Archiv des FSB, und jedes Mal ist es anstrengend. Ich muss mich überwinden. Also: Ins Archiv gehen, fragen, reden? „Nein, das will ich nicht. Soll das doch jemand anderes machen.“ Und wenn jetzt die Leute zu uns kommen, dann muss ich ihnen erklären, dass ich ja an ihrer Stelle gehen und [Anfragen] schreiben würde, dass ich aber nicht das Recht dazu habe. Weil das Recht auf Fragen laut den jetzigen Vorschriften nur Verwandte der Betroffenen haben. Und sie müssen Dokumente vorlegen, die die Verwandtschaft bezeugen.
Das ist eine ganz eigene Geschichte. Seine eigene Geburtsurkunde kann man ja vielleicht noch finden, aber wie soll ich etwa beweisen, dass der Betreffende der Bruder meiner Großmutter ist? Um zu beweisen, dass sie Bruder und Schwester sind, muss die Geburtsurkunde des einen wie der anderen gefunden werden. Das ist unrealistisch. Völlig unrealistisch, da darf man sich nichts vormachen. Wenn wir aber eine Verwandtschaft nicht nachweisen können, dann halten es staatliche Archive, sagen wir es mal politisch korrekt, für ihr Recht, eine Absage zu erteilen: „Sie haben nicht das Recht, sich mit den Dokumenten vertraut zu machen.“
In Wirklichkeit ist aber alles nicht ganz so streng, weil es diesen Begriff gibt: „Ablauf der Schutzfrist“. Dann ist die Zeit abgelaufen, in der ein Dokument aufbewahrt werden muss, ohne öffentlich zugänglich zu sein. In der allgemeinen Praxis sind das 75 Jahre, dann wird alles in die allgemeine staatliche Aufbewahrung überführt.
Und es ist alles noch ein bisschen anders, nämlich sehr viel komplexer und verzwickter: In der einen Stadt kann es eine Regelung geben, in einer anderen Stadt eine andere. Oder, wenn es um Ermittlungsverfahren, um Opfer der Repressionen geht, kann es bedeuten, dass ein Teil [der Dokumente] im Archiv des FSB verbleibt. In der allgemeinen staatlichen Aufbewahrung ist es einfacher. Wenn es aber ein FSB-Archiv ist, liegen die Dinge anders. Und beim Archiv des Innenministeriums geht gar nichts.

So eine Suche ist immer sehr vielschichtig. Vor einer Weile habe ich mit einer jungen Frau, die mit der Zeit schon eine gute Bekannte wurde, vier Jahre lang, glaube ich, gesucht und Anfragen geschrieben. 78 oder 87, wenn ich mich nicht irre. Weil die Suche aufs Geratewohl erfolgte, wirklich aufs Geratewohl.
Es war eine interessante Geschichte, weil sie wusste, dass ihr Urgroßvater verhaftet wurde und dann etwas mit ihm passiert war. Das war alles, mehr wusste sie nicht. Sie wusste ungefähr, in welcher Stadt das alles geschehen sein könnte. Und wir suchten zusammen. Aber was heißt „wir“? Sie fragte mich, wohin man schreiben könnte, und ich schrieb, sagte ihr, wohin, nannte die Adresse und entwarf den Text für die Anfrage. Sie schrieb ihn dann etwas um und schickte die Anfrage los. Die Antwort war negativ: Es gebe keine Unterlagen.
Meiner Meinung nach ist eine abschlägige Antwort auch eine Antwort, es ist immerhin eine Information. Wenn wir in dieser Ecke schon erfolglos gestöbert haben, müssen wir die Suche halt anderswo ausweiten.
So ging das jahrelang und blieb lange ergebnislos. Keine Unterlagen, nichts, keine Mitteilungen, die Namen waren nirgendwo registriert. Irgendwann kommt aber doch eine Information, und an die klammerst du dich sofort und überlegst, welche Hinweise du daraus schöpfen kannst, um in der richtigen Richtung weiterzusuchen.
Letzten Endes haben wir über diesen ihren Urgroßvater absolut alles herausgefunden. Wann er verhaftet wurde, [Details über] das Ermittlungsverfahren, weswegen er angeklagt wurde, wie das Urteil lautete und wohin er danach gebracht wurde. Wir fanden den Ort, an den er geschickt wurde. Von dort wurde er in ein anderes Lager verlegt. Und auch das fanden wir. In diesem anderen Lager – vielleicht sogar in einem dritten, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen – ist er gestorben. Und wir fanden seine Lagerakte, und den Ort, an dem er begraben wurde. Das war natürlich kein richtiges Grab. Sowas war ausgeschlossen. Wir fanden den Ort des Lagerfriedhofs. Und die Frau, die war super: Sie fuhr dorthin. Schließlich schrieb sie mir, dass sie ihren Nachnamen geändert habe und jetzt mit dem Namen ihres Urgroßvaters lebe.
Sie hatte ihn nie gesehen. Es gab [bei ihr] so viel und so starke Anteilnahme, dieses große Bedürfnis nach einem Kontakt, einer Fortsetzung. Schließlich können wir die Sache auch so betrachten: Er wurde zertreten, ermordet, vernichtet, sein Leben wurde absolut in Stücke geschlagen. Und jetzt? Habe ich ihn jetzt vergessen? Habe ich mich von ihm losgesagt? Oder habe ich alles getan, was in meinen Kräften steht, damit er nicht vergessen wird?
Auch hier ist alles sehr individuell. Mir scheint, dass wir einen gewissen Schlussstrich ziehen, analysieren und sagen können, dass jemand nicht unbedingt etwas über jenen Menschen verstehen will, sondern über sich selbst. „Wer bin ich? Da ist mein Urgroßvater. In gewisser Weise bin ich eine Fortsetzung von ihm.“ Verzeihen Sie die fürchterliche Banalität, aber: „…in mir fließt sein Blut; wenn ich nicht weiß, wer er ist, wie kann ich dann etwas über mich sagen?“
Es gab einen Fall, eine echte Anekdote, als zu uns zu Memorial jemand von der Steuerinspektion kam und uns überprüfen wollte. Wie sich später herausstellte, hatte man ihm gesagt: „Such’ so lange, bis du etwas findest.“ Und er saß bei uns, in einem unserer Zimmer, weil wir keinen anderen Platz hatten. Wir haben ihn einfach da hingesetzt, wo es einen Stuhl mit Tisch gab.
Nun, am ersten Tag war es so lala mit ihm. Dann ging die Arbeit weiter, wir hatten ja viel zu tun, niemand war mehr zurückhaltend seinetwegen, überhaupt achtete niemand mehr auf ihn. Da sitzt jemand und stöbert in irgendwelchen Papieren der Buchhaltung. Soll er doch sitzen und stöbern.
Nach einiger Zeit kam er an und sagte: „Hören Sie, ich versteh’ das nicht. Ich sitze hier und rundherum gibt es nur ‚verhaftet‘, ‚verhaftet‘, ‚repressiert‘, ‚im Lager erschossen‘… Man kriegt den Eindruck, dass alle…“
Wir fragen ihn: „Wissen Sie eigentlich etwas über Ihre Großväter, oder Ihre Urgroßväter?“ – „Ja“, sagt er, „ich weiß, dass einer während des Krieges gestorben ist.“ Ich schaue nach: „Wie hieß er nochmal?“ Das Ergebnis: erschossen, liegt in Butowo [Friedhof und insbesondere 1937/38 berüchtigte Hinrichtungsstätte bei Moskau]. Wir fragen weiter: „Und woher wissen Sie, dass er während des Krieges starb?“ – „Meine Mutter hat das gesagt.“ – „Wissen Sie, er ist nicht im Krieg gestorben.“ – „Das kann nicht sein.“
Wir versuchen alles, damit das, was in unserer Datenbank steht, damit jede Information durch Dokumente belegt ist. Und sei die Information noch so spärlich, nur eine Zeile… dafür aber ein Dokument, dem man vertrauen kann. Einem Protokoll über die Vollstreckung eines Todesurteils zum Beispiel muss man einfach trauen.
Also steht dieser junge Mann vor mir und ruft zu Hause an und sagt: „Mama, ich bin gerade bei Memorial. Du hast doch immer gesagt, dass mein Opa während des Krieges gestorben ist. Er wurde aber hingerichtet.“ (Könnte auch sein Uropa gewesen sein.) Sie sagt: „Ja, aber es ist besser, wenn du davon nichts weißt.“
Wie sich die Aufregung gelegt hat? Wie die Sache ausging? Was meinen Sie? Der junge Mann hat bei der Steuerinspektion gekündigt.
Es sind Schichten dieser Art, die hier freigelegt werden.
Ich weiß nicht, vielleicht sollten sich nicht Historiker oder Archivare, sondern eher Psychologen mit diesem Thema befassen, darüber nachdenken und beurteilen: Warum reden wir nicht? Warum verheimlichen wir den nachfolgenden Generationen etwas, den Enkeln der Opfer der Repressionen, den eigenen Kindern oder sogar den eigenen Enkeln oder Urenkeln?
Auch das ist vielschichtig, ist alles nicht so einfach. Zum einen, weil nicht zu fragen damals das A und O war, diese eiserne Regel kannte jeder. Nicht zu fragen, nicht zu reden… „Warum haben Sie Ihre Mutter nicht gefragt?" – „Weil eh’ klar war, dass nicht gefragt werden sollte.“ Ich frage: „Warum war das eh’ klar? Hat Sie Ihnen das erklärt?“ – „Was gab’s da zu erklären? Das konnte man doch in der Luft greifen.“ Das ist der erste Punkt.
Zweitens hat man es uns allen, und das gilt auch für mich, eingebläut: Über alles, was zu Hause geschieht, wird draußen nicht geredet. Die Tür bleibt gewissermaßen zu. Hier ist unsere Welt, dort eine fremde. Und die ist feindlich, man darf nicht mit offenem Herzen dort hinausgehen.
Ich muss leider gestehen, dass ich vor Kurzem mein eigenes traumatisches Erlebnis hatte: Es stellte sich heraus, dass auch ich mich meinen Kindern gegenüber so verhalten hatte. Das habe ich wohl unbewusst getan, aber es wurde mir ziemlich klargemacht. Vor einiger Zeit kam mein jüngerer Sohn zu mir und sagte: „Hör mal, Du hast doch immer gesagt, dass man das, was bei uns geschieht, niemandem erzählen soll.“ Und er sagte dann, er habe das seiner Frau erzählt, dass man das, was bei uns geschieht, niemandem erzählen soll. Die habe daraufhin gefragt: „Und warum?“ Er wusste keine Antwort. Jetzt kam er zu mir, und ich wusste auch keine Antwort – außer loszuheulen wie ein Schlosshund.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Wie Archive die Weltanschauung und die Vorstellung von der Vergangenheit verändern.

Ich bin überhaupt kein Archivmensch. Mehr noch: Ich war kein Archivhistoriker, also in dem Sinne, dass ich zwar Geschichte studiert habe, aber nicht diese akademische, ja religiöse Vorstellung hatte, dass ich allein aus den Archiven heraus etwas verstehe oder, dass ich ohne Archive wissenschaftlich nicht tragbar bin. Aber dann ging ich, als ich bei Memorial für eine Sache aktiv war, ins russische Staatsarchiv, wo die Akten der Ermittlungsverfahren gegen die politischen Angeklagten aus der gesamten Sowjetzeit liegen. Das sind über 100.000 Fälle. Und das hat nicht nur einen Eindruck bei mir hinterlassen, sondern schlichtweg fundamental meine Vorstellung davon verändert, wie ich über meine eigene Vergangenheit nachdenken muss, über die sowjetische Vergangenheit, über dies ganze Leben. Und deshalb denke ich seither immer auf ganz unterschiedliche Art und Weise darüber nach.
Ein großer Teil solcher Ermittlungsakten liegt in den Archiven des Inlandsgeheimdienstes FSB in den verschiedenen Regionen. Der Zugang zu ihnen ist allerdings sehr eingeschränkt. Man muss entweder extra ein Verwandtschaftsverhältnis zu der Person nachweisen, deren Akte man einsehen möchte. Oder man schreibt einen eigenen Antrag, wobei du dann keine Kopien machen kannst, weil du kein Verwandter bist. Dann wird die Arbeit mit der Akte zeitlich recht eingeschränkt, man kann nicht alles machen.
Im russischen Staatsarchiv (GARF) geht es fast schon glatt. Es ist eines der sehr wenigen russischsprachigen Archive, in denen diese Art von Akten überhaupt zugänglich ist. Sehr wichtig ist hier, dass ich diese Akten überhaupt gesehen habe, und zwar zehntausende. Und davon will ich erzählen…
Ich möchte noch eine weitere allgemeine Sache zum äußeren Rahmen sagen, die mir wichtig erscheint. Ich denke, das erste, was mich so verblüffte, war der Gedanke: Warum werden diese Akten überhaupt noch aufbewahrt? Es sind Akten zu Verfahren gegen Menschen, die nach „politischen“ Paragrafen beschuldigt wurden, hauptsächlich nach dem Paragrafen 58 [des Strafgesetzbuches der RSFSR]. Diese Akten sind mit dem Vermerk „Aufbewahren für alle Zeit!“ gestempelt. Sie betreffen verschiedene Menschen, die niemand kennt. Und das Einzige, was wir über sie wissen, erschließt sich aus einer Akte, die dazu angelegt wurde, um sie eines Verbrechens zu beschuldigen.

Dabei handelt es sich sehr häufig um Menschen, die nicht einmal des Schreibens mächtig waren. Also Menschen, die nichts über sich selbst aufschreiben konnten, Menschen, die statt einer Unterschrift ein Kreuz unter ihre Aussagen machten. Und meine erste menschliche, literarische, spontane Reaktion war: Ich sehe hier eine riesige sowjetische Verschwörungstheorie. Es ging um eine riesige, gigantische Verschwörung, um eine unglaubliche Menge vermeintlicher Feinde, mit denen unser ganzes Leben durchsetzt sei. Und die uns schaden wollten. Jemand arbeitet als Garderobenfrau in einem Dorfclub und wird beschuldigt, dass sie, während sie — wie bei [dem Schriftsteller Michail Soschtschenko] — die „Mäntels“ der Partei- und Komsomolfunktionäre aufhängt, dort ihre Haare mit Läusen verstreut. Sie habe versucht, die Mäntel zu verlausen. Zu der Akte gehört ein Umschlag mit Haaren von ihr und ein Gutachten darüber, ob es dort Läuse gibt.
Oder der Fall eines jungen Mannes, der es während des Verhörs irgendwie fertigbrachte, aus dem Verhörraum zu entwischen – ein ganz seltener Fall – und aus dem Fenster zu springen, um sich umzubringen. Er überlebte aber, und das Verfahren lief weiter. In der Akte liegt ein Foto des zerbrochenen Fensters.
Die Menschen sind miteinander verwoben, weil ja die Logik und Pragmatik des Ermittlers darin besteht, sich nicht einen einzelnen Menschen vorzunehmen, sondern eine Gruppe zu „enttarnen“. So wird es gemacht, so ist es effektiver, so ist es im Sinne eines Aufstiegs im Apparat richtiger. Deshalb muss ein Mensch im Idealfall mit drei, fünf, zehn anderen in Verbindung stehen. Und wenn man das konsequent liest, sieht man, wie sich diese Netze immer mehr ausbreiten und wer mit wem verknüpft wird.
Ein dritter Gedanke: Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das eine endlose Wiederholung war, das Reden darüber, dass wir ständig in einer Art schuldig sind, dass es eine riesige Schuld gibt, die uns sehr stark belastet. Mit „wir“ sind die Protagonisten dieser Akten gemeint. Wir sollen bereuen, Buße tun oder aber im Gegenteil widerlegen, dass wir angeblich jemand sind, der nicht [ins System] hineinpasst.
Diese drei Wesenskerne geben, wenn man sie zusammenführt, eine Vorstellung davon, was das für eine Vergangenheit war, und was wir aus dieser Vergangenheit in unser heutiges Leben mitgenommen haben. Das ist der allgemeine Rahmen für jede Geschichte, die ich heute erzählen kann.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Die Geschichte von Nina Gnewkowskaja, die zuerst von Berija umworben wurde, dafür ins Lager kam, später als Ermittlerin der Staatsanwaltschaft Dissidenten verfolgte und dann als Opfer politischer Repressionen anerkannt werden wollte.

Dies ist die Geschichte einer Frau, die Nina Gnewkowskaja hieß. Ich habe von ihr auf folgende Weise erfahren: Ein Kollege von Memorial bat mich, im Katalog des Staatsarchivs (GARF) nachzuschauen, ob es in den Beständen, zu denen ich arbeitete, nicht Unterlagen über diese Frau gebe. Sie war durch einige Aufzeichnungen von Dissidenten als eine Ermittlerin bekannt, die zu Hausdurchsuchungen hinzukam und sich dort recht speziell verhielt. Sie stach heraus, war anders. Ich fand ihre Akte.
Und dass ich dort ihre Akte fand, bedeutete, dass sie dort nicht als Ermittlerin in Erscheinung tritt, sondern als Beschuldigte. Und ich erfuhr, dass sie als junge Frau Ende der 1940er Jahre zu den Kreisen der „goldenen“ Nachkriegsjugend gehörte. Das waren Menschen, die entweder Kinder privilegierter Eltern waren, oder auf andere Weise in diese Kreise gelangten, wo sie von allen möglichen Trophäen umgeben waren [hochwertige Alltagsgegenstände, zum Teil in Deutschland geplünderte „Kriegstrophäen“]. Das war wie in der Frühzeit des amerikanischen Jazz: die Klamotten, all die Restaurants in den Hotels im Moskauer Stadtzentrum…



So beginnt die Geschichte, und dann gab es einen Moment, da sie sich zu einer Geschichte weiterentwickelte, in der Geheimdienstchef Berija ein Auge auf Gnewkowskaja warf, in der ein Adjutant Berijas ihr nachstellte, und in der sie in die Datscha Berijas vor der Stadt kam und dort von Berija vergewaltigt wurde. In der Akte wird das recht bemerkenswert beschrieben. Dort ist kein einziges Mal direkt von sexueller Gewalt die Rede. Aber es gibt eine Menge sehr komplizierter Formen des Verschweigens. Wir verstehen schließlich, dass ihre Beziehung zu Berija schon recht lange währte.
Die Geschichte endete, wie solche Geschichten stets enden, mit einer Anklage. Die Anklage gegen sie lief darauf hinaus, dass sie Mitglieder der sowjetischen Regierung verleumdet habe. Das war ein Euphemismus in Bezug auf Berija. Der hatte sie vergewaltigt, und sie hatte im Kreise ihrer Freunde darüber geredet, wodurch es bekannt wurde: Gerüchte waren im Umlauf. Später landete sie im Lager. Davon ist aber in der Akte schon nichts mehr zu finden.
Insgesamt ergaben sich für mich zwei Ausgangspunkte.
Diese Geschichten hinterließen einen großen Eindruck auf mich. Ich beschloss, dass ich beide Seiten betrachten muss. Später konnten wir die Lücken schließen, herausfinden, was davor und danach passiert war. Und wir fanden Memoiren, in denen über Nina Gnewkowskaja während ihrer Zeit im Lager berichtet wird. Dort hieß es über sie, dass sie sich im Lager zwar nicht besonders gut geführt habe, sich aber aus Sicht der politischen Gefangenen jener Zeit anscheinend korrekt verhielt. Das heißt, Menschen, die später in Dissidentenkreisen geachtet wurden, schrieben, dass sie insgesamt eine gute Person gewesen sei und niemanden verraten habe. Sie arbeitete in der Küche, was eine recht privilegierte Stellung war. Sie nutzte das aber nicht so drastisch aus, wie das Leute mit diesen Privilegien hätten tun können.


Dadurch erhielten wir eine dritte Seite des Bildes. Sie ist also anfangs eine junge Frau aus dieser „goldenen Jugend“, im Lager verhält sie sich anscheinend gut. Und dann (nach dem Tod Stalins, den Rehabilitierungen, und nachdem ihre Aussagen anscheinend in das große Verfahren gegen Berija aufgenommen wurden), ist sie buchstäblich zehn Jahre später bereits Ermittlerin der Staatsanwaltschaft.
Hier muss man allerdings im Hinterkopf haben, dass bereits in ihrem Personalbogen in der Ermittlungsakte ihr Studium an der juristischen Fakultät erwähnt wird. Das bedeutet, dass ihre Karriere im Grunde schon in eine bestimmte Richtung wies, und sie sich nicht zufällig in diesem Kreis relativ gut gestellter junger Menschen bewegte. Ihr Vater arbeitete zwar nicht bei den „Organen“ [der Staatssicherheit], doch immerhin bei der Staatsanwaltschaft. Und dann kam die große Wende.
Sie identifizierte sich also etliche Zeit später wieder als Opfer, nicht als Ermittlerin. Und wir mussten nachdenken: darüber, ob das immer noch dieselbe Nina Gnewkowskaja war, die eine solche Evolution durchmacht — oder eine Person, die sich, sagen wir, an das anpasste, was in der jeweiligen Zeit am stärksten als gesellschaftliche Norm galt.
Später wurde uns klar, dass das noch nicht alles war. Denn es gibt da auch ihr Interview vom Anfang der 2000er Jahre, in einer Fernsehsendung, einer politischen Talkshow, in der es um das Jahr 1968 und die Demonstration der sieben Dissidenten auf dem Roten Platz ging. [Diese hatten gegen den Einmarsch sowjetischer Truppen in Prag protestiert.] Gnewkowskaja hatte zu unterschiedlicher Zeit zwei Verfahren gegen diese Personen geführt. Sie hatte [als Ermittlerin] Larissa Bogoras gegenüber gesessen, und sie hatte davor schon das Verfahren gegen Wadim Delon geleitet. Da ist also dieses Fernsehinterview, in dem sie nichts darüber sagt, dass sie selbst Opfer war. Sie sagt im Gegenteil: Ja, ich habe das Verfahren geleitet; jetzt wird wenig darüber gesprochen, aber all diese Dissidenten, die arbeiteten für Amerika, das waren völlig korrupte, zynische Leute; die hatten keinerlei idealistische Ansichten, mit denen ist alles klar.
Vollzog sie also eine weitere Wende? Oder erlebten wir sie von dieser Seite, weil es aus ihrer Sicht Anfang der 2000er Jahre im Prinzip ganz natürlich war, sich in das Narrativ der frühen Putin-Ära zu fügen?

Das ist natürlich eine recht seltene Geschichte, weil es nur selten gelingt, eine derartige Menge von Verwandlungen aufzuspüren, nachzuvollziehen. Ich habe immer darauf geachtet, inwieweit die Quellen, aus denen wir unsere Informationen erhalten, und die Art und Weise, wie eine Geschichte dort erzählt wird, es uns ermöglichen, in ein und derselben Person eine solche Menge klassischer sowjetischer Sujets zu erkennen, nämlich: „Oh, das ist ein böser Ermittler“ oder „Oh, das ist ein unglückliches Opfer, das rehabilitiert werden muss, und das alle möglichen Rechte haben sollte“ und so weiter. Anscheinend besteht das Komplexe dieser Geschichten darin, dass weder das eine noch das andere in vollem Maße zutrifft.
Es gibt übrigens eine sehr gute, eine wichtige These, die der israelische Professor Igal Halfin brillant formuliert hat. Er sagt, dass hinter der Akte im Grunde ein realer Mensch steht, mit dem das alles geschah. Und dann gibt es den Protagonisten des Verfahrens mit gleichem Namen, der innerhalb des Verfahrens, in der Akte, im Grunde als literarische Figur fungiert. Ich betrachte diese Akten jetzt irgendwie auch als Romane des sozialistischen Realismus.
Die Geschichte von Nina Gnewkowskaja ist wirklich sehr interessant. Denn ihr Verfahren ist… ich will nicht sagen, dass es schmutzig ist, aber die Akte deutet sehr stark darauf hin, dass sie emotional und moralisch vernichtet werden sollte. In der Akte wird sehr viel davon gesprochen, dass sie eine unsittliche junge Frau sei, dass sie sich mit ihren 19, 20 Jahren mit Männern im Hotel Astoria oder im Metropol treffe… Es ist eine sehr typische sowjetische Methode, eine Verleumdung, die signalisieren soll, dass du nicht nur politisch verkommen bist, sondern auch moralisch. Und Gnewkowskaja wird durch sämtliche Varianten der moralischen Zersetzung geschickt. Bei ihrem Verhältnis zu Berija wird die moralische Komponente natürlich ebenfalls sehr stark betont. Wir wissen aus vielen Gewaltgeschichten dieser Art, dass dies die Betroffenen immer fürchterlich verletzt.
Und wenn sich dann die Rolle ändert… In ihren Verhören, die ich einsehen konnte… Genauer gesagt, habe ich nicht immer die Verhöre selbst einsehen können, weil es sehr viel schwieriger ist, Akten zu den Dissidenten vollständig einzusehen. Aber beim ersten Verfahren gegen Wadim Delon, das sie führte, da fiel mir zum Beispiel auf, dass sie sehr wenig davon sprach, was er selbst verbrochen habe, sondern eher darüber, dass er eine zweifelhafte Beziehung zu einer jungen Frau führe. Darüber sprach sie wohl später auch mit seinen Eltern. Ich erkannte hierin ein sehr ähnliches Motiv, bei dem sie im Grunde eine ihr selbst sehr bekannte Taktik verfolgte.
Das schien mir absolut kein Zufall zu sein. Später wurde bei verschiedenen Berichten über ihr Verhalten zum Beispiel betont, dass sie bei Hausdurchsuchungen stets sehr schön geschminkt und gut gekleidet erschien. Ljudmila Alexejewa, glaube ich, hat geschrieben, dass Gnewkowskaja in den Schrank schaute und sagte: „Na, warum hängt hier denn nur ein Mantel? Wo sind Ihre amerikanischen Gelder? Wofür geben Sie die eigentlich aus?“ Es war die Idee, sich — gewissermaßen sexualisiert — als starke Frau zu präsentieren.
Meines Wissens hatte sie keine Kinder und war nie verheiratet. Das bedeutet, dass alles, was mit dem anfänglichen Versuch verbunden war, sie moralisch zu brechen, später auf unterschiedliche Weise an die Oberfläche kam.
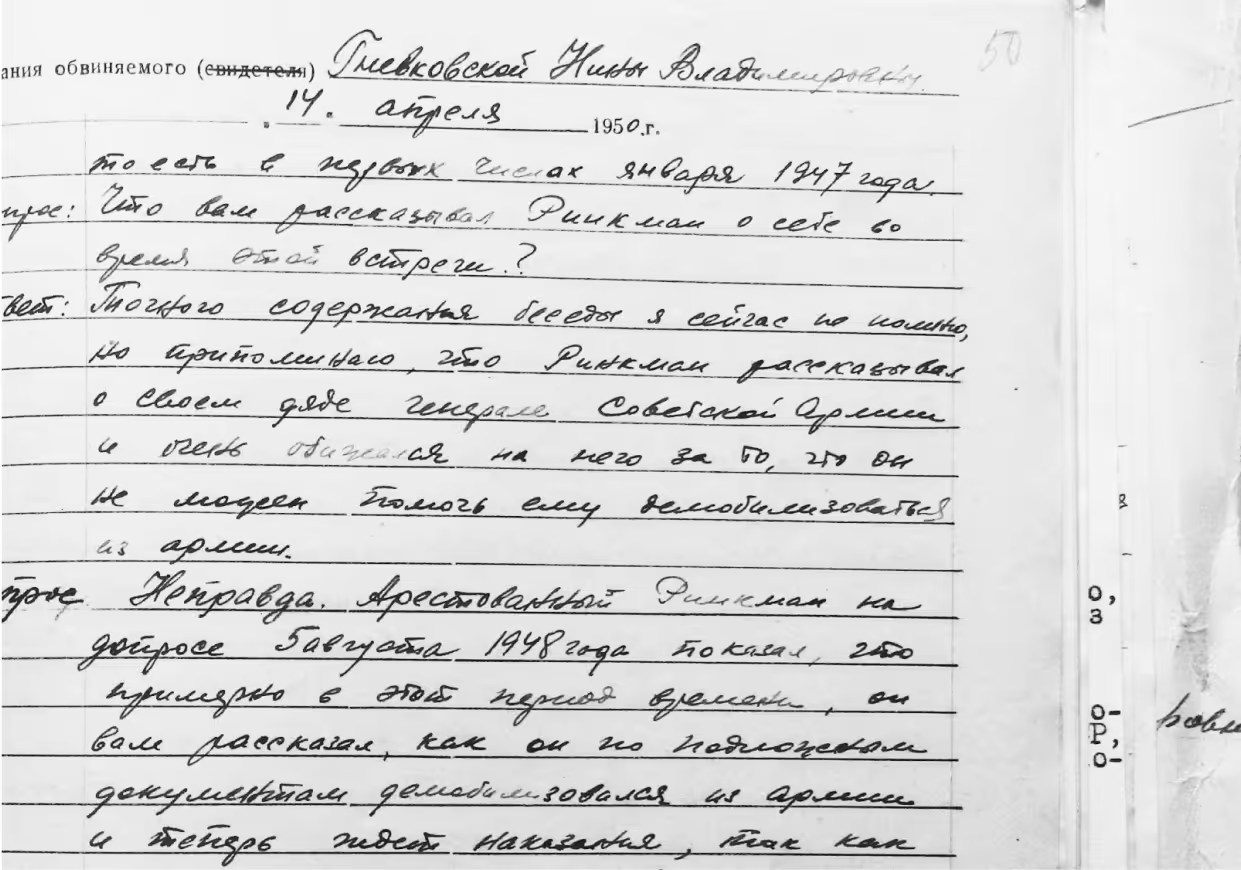

Das ist natürlich zu stark psychologisiert; wir haben schon darüber diskutiert: Sollten wir beispielsweise annehmen oder sagen, dass das, was ihr zu Beginn widerfuhr, was wir aus den Akten wissen, die Beschreibung ihres Niedergangs, dass das gewissermaßen eine Erklärung ist? Eine Erklärung dafür, dass sie später in ihrer neuen Rolle selbst versuchte, Menschen zu brechen? Das ist für mich eine zu drastische und schwierige Aussage. Es bleibt eine große Frage, ob wir das so sagen können.
Was wir aber meiner Ansicht nach festhalten können — und zwar aufgrund der Dokumente —, ist etwas, was ich eine gemeinsame Abhängigkeit der Ermittlerin und der Person nennen möchte, mit der sie im Verhör spricht. Das heißt, in Wirklichkeit operieren sie… sie agieren beide im Rahmen einer Sprache, eines Wertesystems, in dem ein moralischer Sturz einen Menschen vollkommen vernichtet. Das alles ist fürchterlich zerstörerisch.
20–25 Jahre später [unter Putin] verwendete sie die gleichen Argumente gegen junge Menschen, die in einer jetzt ganz anderen Zeit protestierten.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Warum die Ermittlungsakten politischer Gefangener eine phänomenale Quelle zum Alltag und zum Geist jener Zeit sind.

Die Akten der Ermittlungsverfahren gegen politische Häftlinge sind im Grunde genommen eine phänomenale Quelle zum gesamten Alltag, zur gesamten Textur jener Zeit. In ihnen kann, abhängig von der Situation, etwas enthalten sein, das dort absolut nicht sein sollte. Und das sonst unter gar keinen Umständen, auf keine andere Weise erhalten geblieben wäre. Die Dokumente sind gewissermaßen eine Zeitkapsel. Jemand hat etwas vergraben, und dann, 50 Jahre später, kommst du und machst sie auf – und siehst, was da ist, was da war.
Dann ist die Frage, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, und wie man damit arbeitet. Ich kann für mich sagen, dass ich durch diese Akten unheimlich viel über den sowjetischen Alltag erfahren oder verstanden habe.
Es ist dennoch ein sehr spezifischer Typ Quelle, es wird ja ein politisches Verbrechen beschrieben, also ein fast religiöses. Sogar die Beschreibung des Verbrechens kann ihren Ausgangspunkt in solchen superkleinen, ungewöhnlichen Details haben.
Wenn wir zum Beispiel versuchen, die Verfahren zu analysieren und sie zu beschreiben, erstellen wir zunächst unseren Sammelbogen mit allen Dingen, die überhaupt erwähnt werden. Wir haben nämlich recht schnell verstanden, dass sich die Angelegenheit eigentlich nie auf den in der Anklage formulierten Handlungsstrang beschränkt. Die Beschuldigung kann schablonenartig sein, und auch der Verlauf der Ermittlungen absolut schablonenhaft. Dort können aber Dinge erwähnt sein, die eigentlich anders funktionieren, und zu denen einfach die richtigen Fragen gestellt werden müssen. Vor allem müssen sie erst einmal entdeckt werden. Dann verstehen wir vielleicht, dass es um etwas ganz anderes gehen könnte.
Da war zum Beispiel ein Straßenbahnschaffner in die Kantine gegangen. Ihm hat dort die Suppe nicht geschmeckt. Später erklärt er:
Das ist eigentlich ein seltener Fall, weil es dafür einen eigenen Strafrechtsparagrafen gab (§ 154a). Es gibt nur wenige solcher Verfahren, die offen zugänglich sind, insbesondere, wenn der Betroffene später deswegen rehabilitiert wurde.
Und noch später erhalten wir aus einem völlig anderen Zusammenhang eine Information über diesen Koch, dass dieser sich negativ über Komsomolzen äußert, ständig mit seiner Partisanen-Bescheinigung auftrumpfte, homosexuell aktiv ist und als Koch nichts Besonderes darstellt. Punkt.

Das ist ein Beispiel dafür, wie sich verschiedene Realitäten und Sujets überlagern: politische, nichtpolitische, und zwar unter ein und denselben Umständen.
All diese Menschen sind, von wenigen Ausnahmen abgesehen, absolut unbekannt. Das größte Problem aber ist, dass wir sie zuerst nur als Figuren bei einem Verbrechen sehen. Sie sind Protagonisten in einem Verfahren zu einem Verbrechen. Und dann besteht unsere Arbeit darin zu versuchen, diese Geschichte zu entwirren. Das heißt, man kann einerseits buchstäblich hinschauen und diese Menschen als Opfer des sowjetischen Terrors betrachten. Es gibt dieses allgemeine Narrativ, die Vorstellung, dass es wichtig ist, sie als Opfer zu sehen: Sie haben sich nichts zuschulden kommen lassen; wir reden ja von Opfern. Der nächste Schritt ist dann, zu versuchen — wenn die Dinge schon geschehen sind und von einem ansonsten absolut unbekannten Menschen nur 100 Seiten Material bleiben (auch wenn das manchmal „erlesen“ ist) — dort etwas zu erkennen, was die Ermittler für uns unbewusst, nicht als Material, hinterlassen haben, und was wir selbst mithilfe verschiedener Fragen daraus extrahieren können.
Das ist wahrscheinlich meine Lieblingsbeschäftigung. Da geht es gar nicht um den sowjetischen Terror, sondern um Menschen. Die sind für mich viel interessanter als die Maschinerie. Denn diese Maschinerie ist im Grunde heute schon gar nicht so schlecht beschrieben. Insbesondere Memorial hat hier sehr gute Arbeit geleistet.
Aber sich konkrete Menschen vorzunehmen, ist ein Problem, ein Fass ohne Boden, weil jeder Mensch anders ist. Die Verfahren sind fast schon schematisch, die Menschen jedoch alle verschieden.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Ermittlungsverfahren als Informationsquelle über Menschen, die sich „außerhalb jeder Erzählung“ befinden.

Es gibt manchmal Material über Menschen einer Kultur, die sonst nicht wahrgenommen würden. Weil sie sich außerhalb jeder Erzählung befinden. Weil es um Menschen geht, die selbst nicht schreiben können und weder Memoiren noch Zeugnisse hinterlassen.
Da gibt es ein Verfahren gegen einen Bauern, zu Beginn des zweiten Fünfjahresplans [1933-1937], aus einem Dorf bei Moskau. Der Fall beginnt buchstäblich damit, dass ein Hund durchs Dorf läuft und ein Schild mit der Aufschrift trägt: „Esst mich am Ende des Fünfjahresplans, Kinder!“ Es war klar, dass es um den Hunger ging. Der Plan soll erfüllt werden, doch im Dorf herrschen fürchterliche Armut und Hunger. [Anfang der 1930er Jahre verhungerten wegen der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft in Zentralrussland und insbesondere in der Ukraine Millionen Menschen.]
Dann kommt eine Parteikommission aus der Hauptstadt in das Dorf, um nach der Ernte zu schauen. Die Bauern sollen ihr berichten, wie gut alles laufe und dass der Plan übererfüllt worden sei. Es folgt ein Ereignis, das dann den eigentlichen Gegenstand des Verfahrens bildet.
Als das bekannt wird (und es wird recht schnell bekannt), wird das als antisowjetische Handlung eingestuft, als ein Verbrechen, weil er Hundefleisch auf den Tisch gestellt hat.
Dieser Fall ist durch die politische Interpretation der Handlung äußerst interessant. Es geht hier zum Beispiel darum, dass es für die Mitglieder der Parteikommission eine Schmach war, weil ihnen danach die Kinder im Dorf hinterher liefen und bellten. Sie wurden auch mit „Hundefänger“ betitelt, weil sie die Schande erlebt hatten, dass man sie mit Hundefleisch bewirtete. Andererseits war es eine Demonstration dieses Bauern, mit der Botschaft: Wir leben so schlecht, wir können euch nichts anderes zu essen geben als diesen Hund.
Schon die Art seines Vorgehens hat mich stark gefesselt. Natürlich gibt es hier eine Vorgeschichte. Hundefleisch aufzutischen… Es gibt zum Beispiel Hinweise in den Akten, dass ihnen [den Parteileuten] anfangs nicht klar war, was das für Fleisch ist. Die Kommission habe den Bauern gefragt: „Was für Fleisch essen wir da?“ Die Antwort: „Das sage ich Ihnen danach. Essen Sie’s, dann werden Sie’s erfahren.“ Weiter gibt es dort ein Gutachten eines Veterinärs, laut dem man anhand der übrig gebliebenen Knochen erkennen kann, dass es ein Hund war.
Wenn wir weiter gehen, gelangen wir in den Bereich der Interpretationen: Wie nämlich der Bauer, die bewirteten Parteileute und die Kinder diese Handlungen aufgefasst haben oder aufgefasst haben könnten. Das verständlichste Motiv lautet wohl: Es war eine Form der Herabsetzung, eine Verspottung der Regierung. Es ist schlichtweg Verhöhnung, ihnen einen Hund aufzutischen, um sie in den Augen des ganzen Dorfes zu erniedrigen.
Die Frage, welche Sinngehalte sich hier ergeben, wie dies in der Akte beschrieben wird, und wie die Struktur und die Punkte der Beschuldigung sind, lässt uns zur Ebene der großen Verallgemeinerung zurückkehren. Und sie führt uns dort zum Problem, wie wir verstehen und dekodieren können, was dieses Regime eigentlich ausmachte.
Ich habe natürlich sofort gedacht, dass es einen kulturellen Hintergrund gibt. Und hier wird es interessant: Es liegt auf der Hand, dass hier ein völlig ungebildeter Mensch handelte. Ich will den Grad seiner Nichtbildung nicht übertreiben. Es scheint, als sei er sogar einige Jahre zur Schule gegangen. Es war aber kein Mensch, der antike Literatur las und Geschichten darüber kannte, wem warum was zu essen gegeben wurde. Er war ein Mensch einer nicht sehr komplexen Kultur, der wohl kaum um die Semantik seines Handelns wissen konnte.
Da ich mich oft in die Welt [des Schriftstellers und Dissidenten Warlam] Schalamow begebe und mich mit ihm beschäftige, erinnere ich mich an seine Erzählung „Der freie Tag“. Dort geht es um einen Priester, der im Lager sitzt und trotzdem versucht, an Sonntagen ein Gebet abzuhalten. Aber dann geben ihm einige „Ganoven“ [nichtpolitische Straftäter im Lager] Essen. Sie sagen: „Iss mit uns.“ Sie sagen, sie hätten unerwartet Kalbfleisch aufgetrieben. Und als der Priester gegessen hat, erzählen sie ihm, dass sie den Welpen geschlachtet haben, den er durchzufüttern versuchte. Kurzum, sie hatten seinen Freund getötet. Dem Priester wird schlecht, er muss sich übergeben…
Es ist eine wunderbare Erzählung, und es gibt eine sehr gute literarische und semantische Beschreibung dazu von Jelena Michailik: Sie konzentriert sich vor allem darauf, dass dies die Beschreibung einer schwarzen Messe ist, und dieser Verkehrung, wenn du sagst, du isst ein [göttliches] Lamm — aber in Wirklichkeit isst du einen Hund. Hier gibt es erneut ein Moment des Grausigen, oder sagen wir: des Makabren.
Ich habe versucht, auf verschiedene Weise zu betrachten, wie das in diesem Ermittlungsverfahren zu Tage tritt. Ich bin verschiedenen Erklärungsansätzen gefolgt, warum die Bewirtung der Parteigenossen mit einem Hund eben ein politischer Akt ist.
Die Geschichte endete damit, dass der Bauer für rund fünf Jahre ins Lager kam.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Wie das Strafverfolgungssystem Menschen entmenschlichte und was das mit Schalamow zu tun hat.

Wir hatten den Fall einer jungen Frau, 19, 20 Jahre alt, die wegen Diskreditierung der sowjetischen Armee verhaftet wurde, wie man heute sagen würde. Sie war im Sommer 1942 Krankenschwester in einer Armeeeinheit gewesen und wurde dann zurück ins Hinterland geschickt. Und als sie irgendwo in Moskau oder im Moskauer Umland unter ihren Altersgenossinnen war, erzählte sie, was sie [an der Front] gesehen hatte: dass alle zurückweichen, dass es an Waffen fehlt, dass ganze Dörfer sich ergeben. Und dass die Deutschen sich insgesamt gar nicht so schrecklich benehmen. Sie war sogar durch einen Teil der besetzten Gebiete gegangen und sei dort nicht angerührt worden.
Das alles wird zur Grundlage einer Anklage. Die junge Frau leugnet alles und sagt, dass es nicht wahr sei: „Mich hat ein Soldat verleumdet, der mit im Zimmer war. Ich habe das überhaupt nicht gesagt, sondern im Gegenteil, dass die sowjetische Armee versucht, alle zu verteidigen.“
Dann versucht der Ermittler, sie bei einer Lüge zu erwischen. Und er sagt, in ihrem Personalbogen stehe… Es ist nämlich sehr wichtig, einen Menschen hier zuerst mithilfe des Personalbogens eines Verhafteten zu betrachten. Das sind zwei Seiten, auf denen die Antworten auf die klassischen sowjetischen Fragen stehen: Name, Vorname, Vatersname, Geburtsort, Herkunft, wer die Eltern waren, Parteizugehörigkeit. Viele der grundlegenden Angaben werden also schon dort gemacht. Und bei der jungen Frau steht in dem Bogen, dass sie Waise ist und in einem Kinderheim aufwuchs.
Und der Ermittler sagt: „Sie sagen, dass Sie Waise sind. Sie versuchen, die Ermittlung zu täuschen. Denn wir haben Briefe an Ihren Vater gefunden und die Antworten Ihres Vaters. Ich habe Sie entlarvt, also haben Sie da gelogen, und den Rest glauben wir Ihnen auch nicht.“ Sie sagt:
Das nächste Verhör beginnt damit, dass der Ermittler diese Geschichte wieder aufgreift und sagt: „Sie lügen uns an, denn wir haben ein Foto ihres Vaters gefunden, da ist es.“ Sie sagt: „Das ist nicht mein Vater. Ich habe eine Zeit lang als Putzfrau in einem Büro gearbeitet, und es gab dort eine Kartei mit Fotos. Ich wollte mir einmal vorstellen, wem ich schreibe und von wem ich Antworten bekomme. Da nahm ich ein Foto und stellte mir vor, das sei mein Vater.“ Das Foto war in der Akte, und es hängt jetzt bei mir zu Hause, weil ich an die junge Frau denken will.

Die Frau erzählt weiter, dass sie in einem Wohnheim gelebt habe. Sie habe sich in eine imaginäre Welt geflüchtet, in der sie Briefe von ihrem Vater bekam, und habe die Briefe in ihrem Wohnheimzimmer anderen Frauen vorgelesen. Es sind sehr gute Briefe. Sie sind in der Akte enthalten.
Es ist eine schwierige Lektüre. Ich dachte über diese „Entliebtheit”, wie man es nennen könnte, nach. Es fällt auf, dass in den Briefen ihre Mutter erwähnt wird, es aber keine Briefe von ihr gibt. Der Vater schreibt ständig, dass die Mutter krank sei und so weiter.
Wenn wir das aber quellentechnisch ganz streng betrachten, erhalten wir keine hundertprozentige Antwort. Es ist nämlich so, dass es einen Vater gegeben haben könnte, und dass die Briefe doch vom Vater sein könnten. Einmal dachte ich, man sollte es mit einem grafologischen Gutachten versuchen… Denn es ist zu erkennen, dass es eine andere Handschrift ist. Aber ich weiß nicht. Vielleicht hat sie ihre Handschrift verstellt, oder sie bat jemand anderen zu schreiben. Im Grunde sehen die Briefe vom Vater recht merkwürdig aus. Wie in Reinschrift, und sie ähneln eher Aufsätzen in einem Schulheft, zu einem vorgegebenen Thema.
Wo liegt hier die Wahrheit, wo die Lüge? Die Ermittler versuchten, die Frau bei einer Lüge zu ertappen in Bezug auf das, was sie über die Armee gesagt hat. Und hier komme ich wieder zu dem Thema zurück, dass sie fürchterlich einsam und unglücklich ist und Halt sucht; sie will, dass jemand ein Gespräch mit ihr führt, einen Dialog.
Insgesamt wird klar, warum sie überhaupt darüber plauderte, was sie an der Front erlebt hatte. Das vermittelt eine gewisse Vorstellung von ihr: von einem Menschen, für den gesellschaftliche Aufmerksamkeit sehr wichtig ist. Sie war zurückgekommen und berichtete allen – und stand dadurch im Mittelpunkt. In den Unterlagen begegnen uns nicht wenige emotionale Dinge wie diese.
Warum denke ich gerade an Entliebtheit, und warum wähle ich dieses Wort? Es entstand, als ich mich mit Warlam Schalamow und seinem Zyklus „Erzählungen aus Kolyma“ befasste. [Kolyma ist eine Region im Norden Sibiriens, in der sich Lager des GULAG mit äußerst harten Lebensbedingungen befanden.]
Eine der Erzählungen heißt „Kinderbildchen“ und ist weniger typisch für Schalamow, denn sie hat praktisch keine Handlung. Sein lyrischer Held findet in einem Haufen Müll neben dem Lager ein Kinderheft. Und er überlegt, wie er es nutzen könnte, vielleicht für selbstgedrehte [Zigaretten] oder etwas anderes. Dann sieht er sich die Bilder in diesem Kinderheft an und erinnert sich, wie er selbst gezeichnet hat, und schaut, was das für Zeichnungen sind, wie dieses Kind diese Welt malt, in der sie alle sich befinden, und was das für eine Welt ist.
Weiter schreibt Schalamow, dass er sich an eine Legende aus dem hohen Norden erinnert. Sie handelt von Gott, der diese Welt im Norden schuf: Kolyma. Diese Welt war sehr rein und sehr schlicht, es gab dort nur zwei, drei Farben, alles war sehr kahl. Dann begriff Gott, dass das zu schlicht ist, zu primitiv, und er vergaß diese Welt. Er verließ sie und ging in den Süden, wo er etwas Komplexeres schuf.
Und es blieb diese entliebte, vergessene Welt zurück, in der es kalt ist, schlecht, in der es nur zwei, drei Farben gibt, in der überhaupt keine Menschen leben sollten. Und in genau diese Welt — vergessen, entliebt, von niemandem gebraucht — wurden politische Häftlinge geschickt. Als ob wir sie entliebt hätten, als ob wir sie nicht bräuchten.

Man kann das, was mit diesen Menschen in den Ermittlungsverfahren geschah, tatsächlich so beschreiben. Ihnen wird ja gesagt: „Ihr seid jetzt nicht mehr so wie wir, ihr seid für uns keine Genossen, ihr seid Feinde, ihr seid keine Brüder, wir sagen uns von euch los.“ — „Nein, ich bin kein Feind, ich bin wie du, ich möchte mit dir zusammen sein, Ermittler, in unserer gemeinsamen sowjetischen Welt.“ — „Nein, du bist jetzt nicht mehr so, du bist keiner von uns. Wir entziehen dir das Recht, ein uns gleichgestellter Mensch zu sein. Und danach können wir vieles mit dir machen, dich im Prinzip auch foltern.“
Wir beschäftigen uns jetzt viel mit Belegen für Folter bei den Ermittlungen. Es gibt dazu eine Formel von Arseni Roginski: Er sagt, in den Protokollen sei das Wichtigste nicht enthalten. Von der Folter steht nämlich in den Akten nur sehr wenig, weil die nicht festgehalten wurde. Sie ist nur manchmal und nur mittelbar zu erkennen oder zu vermuten.
Etwa, wenn das Verhör um neun Uhr abends beginnt und, sagen wir, um sieben am nächsten Morgen endet, wobei das Protokoll nur aus anderthalb Seiten besteht. Was in den zehn Stunden passierte, bleibt unklar.
Wir wissen aber: Wenn wir diese Geschichten genau nachverfolgen, dann tauchen in den Unterlagen zur Rehabilitierung oder manchmal sogar in den Anträgen, die jemand schon aus dem Lager heraus stellte, um eine Revision seines Verfahrens zu erreichen, Berichte über Folter auf. Wenn jemand beschreibt, warum er genötigt war, seine Aussagen zu unterschreiben, und wie das geschah, dann sind das völlig abnormale Geschichten. Alles, was man sich nur vorstellen kann, wie im Kino — und darüber hinaus.
Jemand beschreibt die Folter so: Man behielt ihn einfach sehr, sehr lange da; es war ein unendlicher Verhörmarathon. Danach wird er aber nicht in die Zelle zurückgebracht, sondern vom Ermittler in dessen Büroschrank gesperrt. Er blieb in diesem Schrank und musste anhören, wie die nächsten gefoltert werden. Der einfache Umstand, dass er sich diese ganze Zeit dort befand, hat ihn schließlich gebrochen.
In den Berichten von Folter gibt es nicht wenige solcher Szenen…
Du stehst einem Menschen gegenüber, und der behandelt dich, als ob du kein Mensch wärst: Du bist entliebt, du bist nicht wie ich, ich kann mit dir machen, was ich will. Dir wird niemand helfen.
Es gibt viele solcher Beispiele, und sie zeigen sich schon in der Sprache. Da gibt es bei den Opfern einerseits Mitleid für sich selbst und andererseits dieses Fragen: Was ist eigentlich geschehen? Was sind das bloß für Menschen, diese Ermittler? Unsowjetische Menschen… Wie konnten sie mir das Recht nehmen, mit ihnen zu sein? Wie kann sowas erlaubt sein?
Was am stärksten beeindruckt: Wir haben einen Text von jemandem, der Ende der 1930er Jahre Anwalt war und daher sehr genau wusste, was in den Vorschriften steht. Er schreibt: „Es ist absolut himmelschreiend, Sie müssen da etwas unternehmen.“ Er schreibt an das Kontaktbüro des NKWD: „Ich sehe einfach, wie die Grundlagen unserer gesamten sowjetischen Ordnung zerstört werden.“

Daran musste ich denken, als ich das Buch „Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten“ von Jean Améry las. Der Autor hat die Lager der Nazis überlebt, er beschreibt vor allem Folter.
Améry sagt, Folter sei eine Sache, aus der man nicht mehr herauskommen könne. Das heißt, wenn dir so etwas geschehen ist, kannst du das als Erlebnis nicht überwinden, es lässt sich nicht wie eine Wunde heilen. Er sagt: Wenn man trotzdem etwas machen könnte, wenn man mich fragte: Was würde dich denn befreien? — Mich würde befreien, wenn ich zusammen mit meinem Henker in die Vergangenheit reisen könnte, und wenn dieser Henker in dieser Vergangenheit mir Mitgefühl zeigte. Wenn er mich im Laufe dieser Folter als Menschen anerkennen und sagen würde: „Es tut mir sehr leid, dass ich das tue.“
Und er sagt: Was mich zum Teil damit versöhnte, war das Wissen, dass ein Teil dieser Henker danach vor Gericht stand und hingerichtet wurde. Und: Ich denke und ich hoffe, dass sie vielleicht in ihren allerletzten Momenten dachten: „Schade, dass ich das alles getan habe. Ich hätte das alles wohl nicht tun sollen.“
Das reicht natürlich nicht, aber es wäre wenigstens etwas. Es würde dich in die Welt der Menschen zurückbringen, in die Welt jener, mit denen man so nicht umgehen darf.
Für mich geht es hier um das Gleiche: um Akzeptanz — oder eben um diese Entliebtheit.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Wie Henker des Großen Terrors selbst zu Angeklagten wurden.

Wir haben uns eine Reihe von Verfahren aus dem Jahr 1939 gegen Menschen angeschaut, die 1937 und 1938 selbst als Ermittler tätig gewesen waren. Nun waren sie Angeklagte. Auf klassisch sowjetische Weise. Warum wurden sie zu Beschuldigten? Nicht etwa, weil das Problem darin bestand, dass die gesamte Politik, der sie gedient hatten, falsch gewesen sei und der Terror ein Fehler. Sondern weil sie angeblich Missbräuche betrieben hätten. Sie waren einfach zu “Feinden” innerhalb des Systems geworden. Und mit diesen Feinden wurde jetzt abgerechnet… Diese Feinde, das waren vor allem lokale Ermittler, die „den Bogen überspannt“ hatten.
Viele dieser Ermittler reagierten sehr heftig, weil sie wussten, was man mit ihnen machen würde. Einmal wird ein Selbstmordversuch beschrieben. Wenn du nämlich weißt, dass du das nicht überstehen wirst, und wenn du sehr wohl weißt, was sie mit dir anstellen werden, und es keinen Ausweg gibt…
Ich verstehe nicht so recht, was das heißt. Hat er etwa Teile von den Sprungfedern abgebrochen? Er hat überlebt: ein sowjetischer Ermittler, der in seiner Zelle Teile seines Metallbetts aß. Später, in den 1950er Jahren, wurde er rehabilitiert.
Dabei waren jene ehemaligen Ermittler während des Verhörs, bei dem sie im Dialog mit den jetzigen Ermittlern standen, Beschuldigte, die sich vollkommen im gleichen Koordinatensystem bewegen, und die daher genauer wissen, was sie sagen müssen. Die Ermittler, über die ich las, verweisen auf konkrete Dinge: „Es gab doch diese Anordnung; mir wurde doch gesagt, dass so vorgegangen werden muss.“
Diese Verfahren sind außerordentlich interessant, weil sie die tatsächliche Faktenlage beschreiben. So heißt es wörtlich: „Ich war damals beim Verhör, schlug den Typen. Dann gab es einen Anruf, ich ging zum Telefon. Sie sagten: ‚Mach ihn fertig.‘“ So war es, so lief es ab. Letztendlich gibt es hier eine Korrelation zum Verhalten von [SS-Obersturmbannführer Adolf] Eichmann vor Gericht:
So nach dem Motto: „Sorry natürlich, aber es musste so gemacht werden; so waren die Regeln.“ Und es wird darüber reflektiert, was man jetzt mit mir anstellen wird: „Es hat einen Fehler gegeben, tut mir das nicht an, das habe ich nicht verdient.“
Es gibt aber einen Ermittler, den ich mit besonderem Interesse verfolge. Er hat einige überaus interessante Verfahren geleitet. Und es ist erkennbar, dass er dadurch Karriere machte. Sein Name war Pawlowski. Er hat recht groß Karriere gemacht. Später aber, Anfang der 1950er Jahre, wurde er selbst verhaftet. Wegen einer internen antijüdischen Geschichte… im MGB, wie der KGB damals hieß.

Die Ermittlungen gegen ihn liefen über ein Jahr, die Unterlagen dazu habe ich nicht zu Gesicht bekommen. Das wäre sehr interessant gewesen. Es gibt aber eine Parteinotiz darüber, was mit ihm geschah, nachdem ein Jahr lang gegen ihn ermittelt wurde.
[Die Dichterin] Natalja Gorbanewskaja, [der Offizier und Dissident] Petro Hryhorenko [russ.: Grigorenko] und [die Dissidentin und später Oppositionspolitikerin] Walerija Nowodworskaja waren dort eingesperrt. Also, er war in dieser Kasaner Psychiatrie, sein Körper versagte, ein Arm gehorchte ihm nicht mehr. Das, was mit ihm geschehen war, hatte ihn also mental gewaltig erschüttert.
Auch, wie er als Ermittler beschrieben wird, ist sehr bezeichnend, weil er beispielsweise einige Verfahren gegen Personen leitete, die schließlich als verrückt eingestuft wurden. Oder das Verhalten dieser Menschen wurde letzten Endes als Wahnsinn interpretiert und gewertet. Gerade dieser Ermittler kam mir sehr expressiv, fast schon theatralisch vor, weil er Verfahren leitete, in denen es um Kunst ging. Später gab es dann auch Gerüchte. Er wurde in den letzten Jahren ein recht bekannter Ermittler und unter denen, gegen die er vorging, kursierte das Gerücht, er sei selbst verrückt geworden. Er soll in der Psychiatrie in Kasan gestorben sein.
In Wirklichkeit starb er nicht dort. Wir haben seine Urne auf dem Moskauer Donskoi-Friedhof gefunden. Einen ganz genauen Nachweis haben wir meiner Meinung nach nicht. Ich nehme aber an, dass er zwar in die Psychiatrie in Kasan geriet, nach einiger Zeit aber wieder entlassen wurde. Und dass er erst fünf, sechs oder sieben Jahre später gestorben ist.
Es ist bezeichnend für jene Zeit, dass ein großer Teil derjenigen, gegen die Pawlowski ermittelte, ebenfalls auf dem Donskoi-Friedhof liegt, während sich nebenan Ermittler Pawlowski vortrefflich in seinem Urnenfach einrichtete. Im Tod entsteht eben eine neue Hierarchie…
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Der absurde Fall einer Psychiatrie, in der die Oberschicht des sowjetischen Regimes behandelt wurde.

Dies ist eine der markantesten Geschichten, ein Blockbuster: das Verfahren zur Psychiatrie in Sokolniki. Anfang, Mitte der 1930er Jahre.Der Inhalt ist grob folgender: In Sokolniki, in einem Moskauer Stadtwald, gibt es eine Einrichtung, halb Sanatorium, halb Psychiatrie. Dort werden viele Parteigenossinnen und -genossen behandelt: wegen eines Nervenzusammenbruchs, Alkoholismus oder wegen der Enttäuschung darüber, dass die Weltrevolution ausblieb.
Es wird ein Verfahren gegen Ärzte dieser Psychiatrie eröffnet. Die hatten den verschiedenen Stationen ihrer Psychiatrie politische Namen gegeben. Die Station für Tobsüchtige hieß „Politbüro“, eine andere „Rat der Volkskommissare“ („Sownarkom“), auch das „Zentrale Exekutivkomitee“ („WZIK“) gab es. Die Patienten werden von den Ärzten einer bestimmten Hierarchie folgend [den Stationen] zugewiesen. So wurde etwa gesagt:

Das Ganze war unglaublich makaber.
Als wir darüber schrieben, zog ich natürlich auch [den Literaturwissenschaftler und Dissidenten] Dmitri Lichatschow und seine Geschichte über die verkehrte Welt hinzu. Über eine Welt wie unsere, nur dass dort alles vollkommen ins Gegenteil verkehrt ist. Diese Psychiatrie in Sokolniki ist eine solche Welt. Dort werden Parteimitglieder, je nach Grad ihres Wahnsinns oder ihrer Verrücktheit, nach einer neuen, karnevalistischen Hierarchie geordnet.
Zum Teil wurde das Verfahren von jenem Ermittler Pawlowski geführt, der auch an anderer Stelle erwähnt wird (s. Wenn Ermittler Teile ihres Zellenbetts essen…). Das Verfahren richtete sich gegen eine Frau namens Nina Tschebarina, eine in dem Krankenhaus praktizierende Ärztin. Eine einfache, nicht besonders hochrangige Ärztin. Anfangs hatte sich das Verfahren auch gegen den Chefarzt gerichtet, der war allerdings eine sehr bekannte Persönlichkeit. Es war Doktor Kirillow, der mit einem der Brüder Lenins befreundet war, dem ältesten der Uljanows. Obwohl es belastende Aussagen gegen ihn gab, wurden schnell alle Anschuldigungen fallen gelassen, weil er wohl für die Regierung eine wichtige Figur war und nicht angerührt werden sollte.
Auf der Ebene der Ärztin aber, die einräumt: „Ja, sowas wurde bei uns gesagt, ich habe das nicht unterbunden und sogar selbst mitgemacht“, da lief das Verfahren weiter. Nebenbei ergibt sich eine unglaublich starke Beschreibung dieser Psychiatrie, die illustriert, wie dieser politische Irrsinn praktiziert wurde.

Einer meiner Lieblingsprotagonisten dabei ist Sergej Minin. Der hatte [im Bürgerkrieg] bei der Verteidigung von Zaryzin [dem heutigen Wolgograd] neben Stalin gestanden. Er war ein derart wichtiges Parteimitglied, dass es zwei Versionen zur Umbenennung der Stadt gibt. „Stalingrad“ setzte sich zwar durch, doch hatte Minin auch „Miningrad“ vorgeschlagen.
Dieser Minin hinterließ äußerst interessante Notizen und Tagebücher. Überhaupt hat er ganz erstaunliche Dinge getan. So beteiligte er sich etwa in der Psychiatrie von Sokolniki an der Inszenierung von Theaterstücken und gab dabei reichlich antisowjetische Dinge von sich. Nach Aussagen von Ohrenzeugen hätten alle ziemlich gelacht. Unter anderem der Chefarzt. Einer der Scherze lautete, dass Stalin und Jenukidse [ein Mitglied der zentralen Kontrollkommission der Partei und Taufpate von Stalins Frau Nadeschda], so wörtlich, „Päderasten“ seien. Daneben gab es ähnlich interessante Sprüche. Und all das wurde in dieser Psychiatrie aufgeführt.
Wenn wir ihren weiteren Weg verfolgen, stellen wir fest, dass sie (weil es in Moskau nicht allzu viele Psychiatrien gab) zum Teil in Krankenhäuser gelangte, in denen sie nun von einigen ihrer früheren Kollegen behandelt wurde.
Weiter erfahren wir, dass sie in verschiedene psychiatrische Arbeitskolonien geschickt wurde, wo sie trotz allem wieder ein wenig arbeitete, auch als Ärztin. Das Letzte, was wir von ihr kennen, ist eine Bescheinigung — schon aus den 1950er Jahren — darüber, dass ihre Rechte vollständig wiederhergestellt wurden und sie wieder als Psychiaterin arbeiten könne. Sie durchläuft also den vollen Zyklus von der Ärztin zur Patientin und dann wieder zur Ärztin.
Des Weiteren erfahren wir, dass der Ermittler Pawlowski später selbst für verrückt erklärt wurde. Das rundet das Bild zusätzlich ab. Und es berührt erneut die Frage, warum diese Episode für mich so wichtig ist: Hier kommt nämlich erneut das System aus Verschwörung und Schuld zum Tragen. Das kommt hier genau an dieser Grenze ins Spiel, an der wir sehen können, dass diese Welt zum Teil einfach verrückt war, so, wie das ganze System funktionierte. Wir sehen es hier als System des reinen Irrsinns.
Und das ist im Grunde eine mögliche und recht legitime Erklärung dafür, was der Terror im Grunde war. Es ist ein bekanntes Argument, dass wir einfach nicht verstehen, was damals geschehen ist. Es war wie eine massenhafte Geistesstörung. Warum werden Leute plötzlich verhaftet, woher diese riesige Menge Anklagen, was ist das für eine Welt? In diesem Sinne ist dieses politische Verfahren zur Psychiatrie fast schon eine Fallstudie. Wichtig ist hier allerdings auch, dass dies ein Verfahren aus einer relativ frühen Phase [der Stalin-Zeit] war, 1933 oder 1934.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Weiße Handschuhe, Bleistift statt Kugelschreiber und die Liebe zu Namensregistern.

Ich glaube, ich bin mit niemandem, der je für mich gearbeitet hat, noch befreundet. Ich übertreibe natürlich etwas, aber generell sollte man schon ein sanftmütiger Mensch sein. Sanftmütig im Umgang mit anderen, nicht überheblich, und das bin ich leider manchmal.
Wenn du jemandem die Archivarbeit beibringen willst, dann gib ihm Papier in die Hand und eine Aufgabe. Das Wichtigste ist, dass man Interesse weckt. Die Neugier, den Spaß an der Sache. Ich bekomme zum Beispiel Dokumente geschenkt — von Bauern, aus dem Gebiet Kostroma. Es sind Fotos dabei, von 1937, 1939. Du schaust dir an, wie die Leute angezogen sind. Denkst dir: spannendes Thema! Da ist zum Beispiel eine Schule zu sehen, Kinder. Welches Jahr ist das? Lächeln sie oder nicht? Dann suchst du nach Bildern einer vergleichbaren Gruppe von Schülern, nur zehn, fünf, sechs Jahre später. Wie verändern sich die Gesichter? Verändern sie sich überhaupt? Vergleichst Bilder aus verschiedenen Ländern, deutsche Gesichter und russische. In den 1950er, 40er, 30er, 20er Jahren. Du fängst an, auf Flohmärkte zu gehen und so weiter ...
Ich bestehe zu einem großen Teil aus Fragen von Freunden, die in meinem Kopf hängen bleiben und auf die ich versuche, Antworten zu finden. Vielleicht wurde die Frage schon vor hundert Jahren gestellt, der Freund hat sie längst vergessen. Im Laufe der Arbeit tauchen zum Beispiel Namen von Personen auf, die nicht auf den Listen der Repressierten bei Memorial stehen. In der Regel wurden diese Menschen ja erschossen. Aber wie viele fehlen dort? Plötzlich tauchen ihre Namen ganz woanders auf, in irgendeiner Frage … Und dann renne ich los und schaue mir polnische Bücher an, ich brauche ein bestimmtes von 1914, das nirgendwo aufzutreiben ist. Im Grunde treibt mich der Spieleifer an.
Wenn die Menschen in den Dokumenten wirklich zum Leben erwachen, besonders in den ersten Phasen der Arbeit, wenn sie plötzlich aus Fleisch und Blut sind, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber im Grunde ist es ganz einfach.
Ich sage Ihnen nachher, welches Buch Sie lesen müssen, wenn das [Diktiergerät] aus ist … Wo Sie mehr über die Archive nachlesen können … ein Sammelband zu meinem 80. Geburtstag. Ich rede nicht gerne über so etwas. Aber es gibt dort eine langjährige Korrespondenz mit Timentschik aus den 1960er Jahren. In welchen Archiven wir waren, was wir alles machen wollten, welche Arbeiten schreiben, was wir über diesen oder jenen herausgefunden haben … Ein Leben im Archiv, umgeben von Papier. Wenn ich das lese, bin ich wirklich fasziniert, wie sehr ich darin … So ist es, wenn man die Menschen plötzlich sieht.
Das Prinzip, nach dem ich mich immer angehalten habe, zu forschen: Kein Material braucht meine Unterschrift, um aus dem Archiv rausgehen zu können. Es darf kein Monopol für Mitarbeitende am Institut geben. Im Sinne von: „Wir geben dieses Material nicht raus, weil irgendein Wissenschaftler gerade daran arbeitet.“ Das ist nicht richtig, vor allem, wenn es ein Institutsmitarbeiter ist. Er darf keine Vorteile haben. Wenn er von irgendwelchen Dokumenten nur von Dienst wegen weiß und nicht aus offenen Quellen, dann ist er einen falschen Weg gegangen.
Ich hatte einmal einen kleinen Konflikt mit meiner Bekannten und ehemaligen Ko-Autorin: Ich habe die Memoiren von Spektorski, einem Rektor der Universität Kyjiw, die als verschollen galten, einem völlig Fremden aus Brjansk zur Verwendung gegeben. Er hat sie veröffentlicht. Da war meine ehemalige Ko-Autorin beleidigt, warum ich sie nicht ihr gegeben hätte. Nun, damit es eben nicht dieses Vitamin B ist.
Wenn du das Material schonen willst, zieh Handschuhe an. Keine Gummihandschuhe, sondern weiße. Wie die Juweliere sie tragen, damit das Gold nicht haften bleibt. Das andere Hauptinstrument ist der Bleistift, kein Kugelschreiber. Ein Kugelschreiber hinterlässt leicht Flecken. Wenn man die Manuskripte paginiert, also die Blätter nummeriert, arbeitet man besser mit Bleistift. Wenn man einen Fehler macht, immer mit einer Linie durchstreichen und neu hinschreiben. Auf keinen Fall ausradieren, das rächt sich früher oder später. Wer weiß nachher, was das zu bedeuten hat? Du hast zum Beispiel einen Nachlass nummeriert und eine Zahl ausgelassen. 56 ist da, 58 ist da, aber 57 hast du vergessen. Also schreibst du: „Ausgelassen.“ Nummerierst nicht neu. Alle Fehler müssen registriert werden.
Wenn wir als Leser ins Archiv kamen, wussten wir ja, dass sehr vieles der Geheimhaltung unterlag, also schauten wir immer auf die Ziffern — was fehlt? Genau wie in den sowjetischen Gesetzen: Du musst immer schauen, welche Aktennummer da steht, welches Symbol hinter dem Schrägstrich und so weiter. Man muss diese ganze Art von Papierkram im Kopf behalten. Es ist ja ein riesiges bürokratisches System, das auf diesen ganzen Symbolen aufbaut. Natürlich sollte ein Archivar das alles wissen, wenn er in der staatlichen oder ministeriellen Archivverwaltung arbeitet. Das ist doch hochgradig interessant!
Und man sollte gerne Namensregister lesen. Ich muss nicht das ganze Buch lesen, das Namensregister sagt mir, wovon es handelt. Das ist eine größere Hilfe als die meisten Anmerkungen, die oft sinnlos sind. Der Titel: „Ankunft“, „Ende“, „Wieder Schnee“ — was sagt das aus? Nicht besonders viel. Aber das Namensregister — eine ganze Menge.
Überhaupt gibt es universelle Eigenschaften von Berufen. Und wenn [der Dichter Wladimir] Majakowski schreibt: „Ich bin Kanalarbeiter und Wasserträger“, dann scheint mir, der Archivar ist so ein Kanalarbeiter. In der Mendelejew-Tabelle [dem Periodensystem der Elemente] würde sich der Archivar mit dem Kanalarbeiter ein Kästchen teilen. Weil er Material aufspürt, reinigt und damit arbeitet.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Eine Original-Mitschrift vom Prozess gegen Joseph Brodsky, ein im Holzschuppen verstecktes Tagebuch und eine nach 30 Jahren zurückgekehrte Aktentasche.

Zum Thema überraschende und einzigartige Entdeckungen, die ich für mich gemacht habe … Als ich anfing, [Lew] Kopelews Nachlass durchzusehen, der hier [im Bremer Archiv] liegt, stieß ich in den Unterlagen seiner Ehefrau Raissa Dawydowna Orlowa auf ein Notizbuch, eine Art Vokabelheft. Mir war sofort klar, dass es eines der Hefte von [Frida] Wigdorowa sein musste, die sie beim Prozess gegen [den Dichter Joseph] Brodsky geführt hatte. Ein Original. Das war natürlich ein großes Ereignis für mich, eine Entdeckung: ein echtes historisches Dokument in meinem eigenen Archiv. Eines von zwei Heften: Das eine befindet sich im Familienbesitz, bei Wigdorowas Tochter, das andere hatte sie Lidija Kornejewna Tschukowskaja geschenkt, die es an [Raissa] Orlowa weitergab.

Ein anderes Dokument, das so einen Kreis vollführt hat, ist das Tagebuch [des Schriftstellers und Dissidenten] Eduard Kusnezow, der 1970 wegen versuchter Flugzeugentführung zum Tode verurteilt und später begnadigt wurde. Er führte im Gefängnis Tagebuch. Einmal bekam sein Mitgefangener Besuch von dessen Frau. Kusnezows Manuskript, eine sogenannte Mikroschrift, hatte ein Heizer zuvor im Holzschuppen deponiert, wo Brennholz fürs Besuchshaus lagerte. Die Frau willigte ein, das präparierte Plastikröhrchen mitzunehmen, brachte es nach Moskau und übergab das Original des Tagebuchs wie vereinbart an einen Freund von Kusnezow. In dem Röhrchen steckte eine Notiz: An den und den aushändigen … Den Namen muss ich hier nicht nennen. Außerdem stand dort: „Vitja, bereite einen Versand in den Westen vor.“ Und diesem Viktor, Kusnezows bestem Freund aus Kindheitstagen, fiel nichts Besseres ein, als es mir zu geben. Also tippte ich das Dokument mit Hilfe meiner Freunde, der Gribanows, in mehreren Exemplaren ab, um es in den Westen zu schicken.

So gelangte die Handschrift zur Aufbewahrung nach Paris: Sobald Kusnezow in Freiheit wäre, sollte er nicht nur das gedruckte Buch, sondern auch das Original in den Händen halten können. Als Kusnezow 1979 schließlich im Rahmen eines Austauschs von sowjetischen Spionen gegen die mutmaßlichen Flugzeugentführer und andere Gefangene freikam, überreichte man ihm das Manuskript.
Bei einem Treffen 1997 in Israel übergab Kusnezow wiederum mir das Manuskript für das Archiv [der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität] in Bremen. So schloss sich der Kreis: Die Handschrift, die ich zum ersten Mal 1971 in den Händen gehalten und abgetippt hatte, war wieder zu mir zurückgekehrt.
Leider konnte Nikita Aleksejewitsch Struwe, der uns den Samisdat übermittelt hat, das maschinengeschriebene Exemplar nicht mehr finden, das als Vorlage für das Buch gedient hatte. Das ist schade, denn die Tschekisten [Geheimdiensmitarbeiter] haben danach gesucht und es nie gefunden.
Ein anderer Fall ist das Tagebuch von Kirill Koszinski, einem Leningrader Schriftsteller und Übersetzer. Für den KGB war er so eine Art Stadtverrückter, der immer protestiert hat, besonders in Anwesenheit von Autoritäten. Schließlich wurde er verhaftet. Im Gefängnis führte er Tagebuch. Bevor er später in den Westen ging, ließ er es in Moskau zurück, vermutlich bei Arina Ginsburg, die dann die Aktentasche mit den Manuskripten an [den Dissidenten und Menschenrechtsaktivisten] Viktor Dsjadko übergab, damit er sie in den Westen schickte. Aber der Versand hat aus irgendeinem Grund nie stattgefunden. Viktor gab sie mir erst Ende der 1990er oder im Jahr 2000 in Moskau. Jetzt bereiten wir das Tagebuch für die Veröffentlichung vor.

Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Warum ein westdeutsches Mädchen Russisch lernte, wie das Dissidenten-Archiv die postsowjetischen Zeiten überlebte und warum im Archivwesen Vertrauen so wichtig ist.

Tatsächlich war es meine Großmutter, die sagte: „Lerne lieber Russisch, wir werden noch mit den Russen zu tun haben, entweder im Guten oder im Bösen.“ Sie sollte recht behalten.
Die Forschungsstelle Osteuropa [an der Universität Bremen] und ihr Archiv wurden gegründet, um zu verstehen, was in den sozialistischen Ländern vor sich ging – aber nicht in Bezug auf Staat und Partei, sondern in Bezug auf die Untergrundkultur, die Dissidenten, Nonkonformen, Unterzeichner [von Manifesten] und so weiter. Es war die einzige Forschungsstelle ihrer Art.
Unsere Tätigkeit umfasste drei Bereiche: Wir sammelten und archivierten Materialien und Literatur unabhängiger Gruppierungen, bereiteten das Ganze wissenschaftlich auf und veröffentlichten es beziehungsweise machten es einem breiten Publikum zugänglich. Also nicht nur der akademischen Welt, sondern allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Das war unser ursprüngliches Ziel, und das hat sich bis heute nicht geändert.

Zynischerweise ist jetzt, angesichts des Kriegs in der Ukraine, allen klar, dass wir nicht nur die Geschichte Russlands und das heutige Russland verstehen müssen, sondern auch ganz allgemein, wie der Widerstand gegen autoritäre Regime funktioniert. Aber es gab auch Zeiten, in denen es Andeutungen und Versuche gab, uns abzuschaffen. Nach 1991 schien alles klar zu sein: Die Sowjetunion war nun Teil des Westens, warum sollte man sich die Mühe machen zu verstehen, woher, warum und so weiter. Wir mussten immer daran erinnern, was unser Archiv so wichtig und einzigartig macht. Verglichen mit deutschen Staatsarchiven haben wir ein völlig anderes Profil: Wir führen ausschließlich Samisdat und die privaten Archive von Dissidenten. Es gibt keine staatlichen Dokumente.
In Bremen haben wir die besondere und seltene Konstruktion, dass wir weder eine universitäre noch eine staatliche Einrichtung sind, sondern etwas dazwischen. Wir unterstehen dem Land Bremen. So wollten die Gründer [der Forschungsstelle] sicherstellen, dass wir wirklich unabhängig und eigenständig arbeiten können und niemand versucht, unsere Einrichtung einfach so zu schließen.
Der Erste, der uns 1989/90 sein privates Archiv zur Verfügung stellte, war Lew Kopelew. Das war eine Art Auszeichnung für uns. Alle, die uns kannten, wussten: Wenn Lew Kopelew uns sein Archiv anvertraut, dann aus gutem Grund. Unser Archiv basiert tatsächlich auf persönlichen Kontakten und Vertrauen. Sonst würden wir gar nicht existieren. Vertrauensvolle Beziehungen sind alles.

Für unsere Geldgeber und diejenigen, die uns ihre Materialien überlassen, ist es sehr wichtig, dass wir ein zuverlässiges nichtstaatliches Archiv sind. Viele Leute hatten beziehungsweise haben immer noch Angst, dass man Material, das in Russland bleibt (in einem russischen Archiv), einfach verstecken, verschwinden lassen oder auseinanderreißen könnte. Für unsere Spenderinnen und Spender ist das Wichtigste, dass sie sich auf uns verlassen können. Sie können sicher sein, dass das Material so, wie sie es uns übergeben haben, bei uns bleibt und bei Bedarf Forschenden frei zugänglich ist, sofern wir das vertraglich so vereinbart haben. Umgekehrt können sie auch jederzeit erklären, dass Material unter Verschluss bleiben soll, und dann bekommt auch wirklich niemand Zugang dazu.
Wir haben noch keine Strategie, wie wir dieses Material in Zukunft systematisch sammeln werden und welches Material der in der fünften Welle Emigrierten wir aufnehmen wollen. Die Formen des Widerstands haben sich verändert, vieles findet im Internet statt.
Aber wir machen trotzdem weiter. Einen großen Teil [unseres Archivs] machen nach wie vor, wenn man so will, die alten Dissidenten aus, Vertreter der vorangegangenen Migrationswellen, die langsam aussterben … Aber ich höre schon, seit ich 2008 hier in Bremen angefangen habe, bald gäbe es niemanden mehr [der uns sein Material überlässt]. Das ist jetzt 16 Jahre her – und bisher ist nichts dergleichen eingetreten.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Warum Kinder die schwierige Vergangenheit kennen sollten und was die Vergangenheit für die Zukunft tun kann.

Es war 1998, ich war gerade in Deutschland und stieß auf ein Projekt — einen Schülerwettbewerb zum Thema Gedenken an das Jahr 1968, ein Jahr, das für Deutschland und Europa insgesamt sehr wichtig ist. Der Wettbewerb richtete sich an Schülerinnen und Schüler älterer Klassen in ganz Deutschland. Ich fand das ungeheuer spannend.
Es handelte sich um ein breit angelegtes Bildungsprojekt, das sich natürlich in erster Linie an Jugendliche richtete. Aber auch Lehrerinnen und Lehrer waren einbezogen und sollten ihren Klassen helfen, außerdem die Familien, regionale Vereine, Zeitzeugen, Menschen aus dem unmittelbaren Umfeld der Schüler. Das war ein einfacher Mechanismus, um ganz unterschiedliche Menschen dazu zu bringen, sich mit Geschichte zu beschäftigen.
In Russland gab es damals ebenfalls zahlreiche Wettbewerbe, aber die waren ganz anders. Ich wollte verstehen: Es ist zehn Jahre her, seit das sowjetische Geschichtsexamen abgeschafft wurde, seitdem sind neue Lehrbücher geschrieben worden. Eine neue Generation ist in dieser neuen Realität aufgewachsen. Was denken diese Jugendlichen, was bringen ihre Lehrerinnen und Lehrer ihnen bei? Wie findet man das heraus, mit welchen Mitteln?
Natürlich dachte ich gleich an Memorial, denn es gab die regionalen Memorial-Büros und damit einen direkten Weg, die Regionen zu erreichen. Geholfen hat uns die Ford Foundation, von der die ersten kleineren Summen an Fördergeld kamen. Natürlich hatten wir vorher versucht, Geld in Russland aufzutreiben. Wir beschlossen dennoch, den Wettbewerb durchzuführen. Wir überlegten genau, wie das alles ablaufen könnte, schauten uns an, wie es in Deutschland funktioniert. Ich habe immer gesagt: „Wir müssen die Aufgabenstellung für Russland möglichst klar und möglichst breit formulieren.“
Was wollten wir? Wir wollten zuallererst das Interesse der Schülerinnen und Schüler an der russischen Geschichte des 20. Jahrhunderts wecken. Wir wollten nicht, dass sie uns einfach Aufsätze zuschicken, sondern wir wollten ihnen zeigen, wie man mit Quellen arbeitet. Es sollten keine bloßen Essays sein, sondern Recherchen. Und im Mittelpunkt dieser Recherchen sollten Menschen stehen. Wenn es zum Beispiel um die Geschichte irgendeines Kraftwerks ging, dann sollte sie anhand des Schicksals etwa eines Ingenieurs erzählt werden; wenn es um eine Schule ging, dann sollten die Schicksale der Lehrerinnen und Schüler im Vordergrund stehen. Der Mensch, sein Leben und sein Schicksal, kommt immer zuerst.
Das Oberthema haben wir in mehrere Unterthemen aufgeteilt: „Familiengeschichte“, „Regionale Geschichte“, „Mensch und Macht“, „Der Preis des Sieges“ (zum Thema Krieg).
Die Recherche war sehr wichtig, denn das Leben und Schicksal des Menschen im 20. Jahrhundert sollte mithilfe von Quellen erzählt werden. Die Quellen konnten sehr unterschiedlich sein: mündliche und schriftliche, persönliche Gespräche, Briefe, Tagebücher und so weiter. Es konnten auch Dokumente aus staatlichen Archiven sein. Wir hatten ja keinen literarischen Wettbewerb ausgeschrieben, sondern einen historischen. Und womit arbeitet ein Historiker? Er arbeitet mit Quellen.
Ich dachte anfangs, wir können froh sein, wenn wir vielleicht zweihundert Zusendungen bekommen. Aber als es dann plötzlich losging … Die wenigsten hatten ja damals einen PC, das meiste war auf der Schreibmaschine oder per Hand geschrieben, alles auf Papier. Wir holten riesige Pakete von der Post, insgesamt waren es, glaube ich, 1.600 Arbeiten.
Darauf waren wir überhaupt nicht vorbereitet. Chaos brach aus. Wir saßen damals in der Maly-Karetny-Gasse, zusammengedrängt wie die Sardinen, und da prasselten diese Tausenden von Arbeiten auf uns ein. Man muss dabei gewesen sein: Ich saß in meinem Eckchen, buchstäblich begraben unter diesem Berg von Schülerarbeiten. Aber es war natürlich unheimlich spannend. Wir entdeckten sofort diverse Dinge, die für uns unerwartet kamen.

Zunächst dachte ich mit Bedauern, dass uns bestimmt nur [Einsendungen aus] den großen Städten [erreichen] würden: Moskau, St. Petersburg. Das war für mich etwas weniger interessant. Aber es kam ganz anders: Mehr als ein Drittel der Arbeiten erreichte uns aus Dörfern und Ortschaften in den abgelegensten Winkeln des Landes. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass sich unser Schülerwettbewerb überhaupt so weit herumsprechen würde.
Das zeigte eindeutig, dass der Bedarf da war. Dass auch die Lehrerinnen und Lehrer ein Bedürfnis nach dieser Art von Reflexion und dieser Art von Arbeit hatten. Zum Teil waren das Vertreterinnen und Vertreter der ländlichen und kleinstädtischen Intelligenzija. So bekamen wir ein Bild von der russischen Provinz (ich liebe dieses Wort, „Regionen“ hingegen finde ich schrecklich). Was in den Köpfen dieser Schülerinnen und Schüler nach zehn Jahren [seit dem Zerfall der UdSSR] vor sich ging, ist eine Geschichte für sich.
Es gab auch Komisches. In einem der ersten Briefe stand: „Wir bitten Sie um Entschuldigung, wir können die Arbeit erst in ein paar Tagen schicken. Die einzige Schreibmaschine steht in der Nachbarschule, aber wegen eines Schneesturms kommen wir nicht mehr hin. Wenn der Schnee etwas getaut ist, werden wir alles abtippen und Ihnen zusenden.“ Und das taten sie auch.

Und weil die Einsendungen nun mal so waren, wie waren, trat allmählich ein Hauptthema in den Vordergrund: die Entkulakisierung [Repressionskampagne gegen wohlhabende Bauern, sogenannte Kulaken, die 1929–1933 massenhaft enteignet, verhaftet, ermordet oder deportiert wurden]. Ich hätte absolut nicht gedacht, dass es praktisch das zentrale Thema dieses Wettbewerbs werden würde. Wobei, eigentlich waren es zwei Themen: die Entkulakisierung und der Krieg.
Dabei gab es einige Mythen, die reproduziert wurden und die wir zurückverfolgen konnten. Zum Beispiel der Mythos vom schönen Russland vor 1917. Dann begann der Erste Weltkrieg. Er wurde teilweise durch den Bürgerkrieg verschluckt, vermischte sich mit diesem. Die Revolution und der Bürgerkrieg haben deutliche Spuren hinterlassen. Ein Junge oder ein Mädchen schrieb: „Und da verlor Russland seine ganze Größe, seinen ganzen Charme.“ „Charme“ war ein wichtiges Wort in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre.
Was das Formelle angeht, so wurde auf alles Mögliche geschrieben und gedruckt. Manchmal auch auf Birkenrinde, wenn bunte Einbände angefertigt und bemalt wurden. Es erinnerte ein wenig an die Schulmuseen der Sowjetzeit.
Die Zeit zwischen dem Bürgerkrieg und etwa 1927 ist geprägt von einem Gefühl des relativen Wohlstands: Hier wird eine Kuh gekauft, dort eine Mühle gebaut … Und dann kommt wieder diese böse Macht: die Entkulakisierung, die das Rückgrat des Dorfes erst richtig bricht.
Interessanterweise wurde der Terror von 1937, der die Stadt so hart traf ... (wobei: nicht nur die Stadt, auch das Land. Denn praktisch alle, die eben erst aus der Verbannung zurückgekehrt waren — wir kennen solche Fälle —, wurden erneut verhaftet. Die erste Operation des Großen Terrors wurde ja sogar als „Kulaken-Operation“ bezeichnet.) Das Thema des Terrors wurde jedenfalls von dieser schrecklichen Tragödie der Entkulakisierung massiv überschattet.
Und dann bricht der totale Krieg aus, der jede und jeden trifft. Und der Hunger, der sich praktisch durch die gesamte erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zieht. Dieses Thema war in der einen oder anderen Form fast überall präsent.
Was wir auch sahen, war der riesige Schmelztiegel der grausamen Mobilisierungswirtschaft, als die Behörden die Menschen einfach so an die unterschiedlichsten Orte verfrachteten. Die massenhafte Zwangsumsiedlung ist eines der Schlüsselbilder dieser Geschichten. Das waren ganz einschneidende Erlebnisse. Wir haben es mit entwurzelten Menschen zu tun, Menschen mit herausgerissenen Wurzeln. Das ist ein zentrales Thema in den sowjetischen Biografien – dieses Herausgerissensein, die Entwurzelung. Auf der anderen Seite steht die Bewahrung des verlorenen Paradieses. Die Erinnerung an das Haus, das Vieh …
Es ist interessant zu sehen, wie das regionale Gedächtnis funktioniert. Bei einem Werk aus St. Petersburg ist es logisch, dass die Erinnerung an die Blockade vieles andere übertönt, nicht wahr?
Da ich gerade bei den Themen bin: Es ist es wichtig zu sagen, dass sie sich ändern, genau wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst. Immerhin sind sozusagen zwei Generationen durch unsere Hände gegangen, das ist sehr interessant.
Die erste, grob gesagt vor 2010, zeigt einen ziemlich freien Umgang mit Geschichte. Die Angst ist weg. Man geht zu einem Einberufungsbüro und sagt: „Geben Sie mir bitte Adressen von Leuten, die im Tschetschenienkrieg gekämpft haben.“ — „Nichts geben wir dir.“ — „Dann gehe eben ich zum FSB. Geben Sie mir die Adressen, ich möchte mit Veteranen sprechen, Interviews führen.“ Der FSB schickt dich auch zum Teufel, aber dann finden sich irgendwelche Bekannten. Es gibt keine Angst mehr, sie ist weg. Vielleicht erreichst du nichts, aber du kannst hingehen, fragen, jemanden nerven, anschreiben, noch mal schreiben – du darfst das, dir wird nichts passieren.
Das war [damals] die Einstellung … Ich fand, dass diese Kinder, die in den 1990er Jahren aufgewachsen sind, reifer waren als die, die nach ihnen kamen. Sie konnten absolut direkte Fragen stellen, offen über etwas schreiben — selbst über ihren Alkoholiker-Vater, über die Mutter, die er in Afghanistan kennenlernte.
Über die Großmutter … Da gibt es natürlich auch komische Geschichten, bei denen man nicht weiß, wie man sie interpretieren soll. Zum Beispiel erzählte jemand eine Liebesgeschichte von seiner Großmutter. Sie hatte einen Verlobten, aber dann ging sie zum Praktikum weg, in den Fernen Osten. Als sie nach dem Praktikum wieder zurück wollte und in den Zug stieg, kam ein NKWD-Mann zu ihr, verhaftete sie und holte sie aus diesem Zug. Es stellte sich heraus, dass er sich in sie verliebt hatte und das seine Art war, sie zu umwerben. Im Endeffekt blieb sie dort und eine glückliche sowjetische Familie entstand. Das Ganze war mit einiger Verwunderung beschrieben, diese Methode des Umwerbens. Daraus [aus solchen Geschichten] ergab sich die Textur des Lebens, und davon gab es eine ganze Menge.

Einmal gab es eine Arbeit, die ich überhaupt nicht zu bewerten wusste. Über Onkel Petja, den Kalmücken. Es war eine baschkirische Schule in einem kleinen Dorf, und in der Schule gab es einen Hausmeister, der alles Mögliche reparierte. Er war sehr gut zu den Kindern, ein alter Mann. Aber sagen wir, wie es ist: Hin und wieder war er dem Alkohol nicht abgeneigt. Jeder wusste, dass er Kalmücke war. Es war klar, dass er von den Kalmücken [westmongolisches Volk, das an der Wolga siedelte] abstammte, die dorthin deportiert worden waren.
Die Lehrerin beschloss herauszufinden, ob er irgendwelche Verwandten hatte. Das ist eine lange Geschichte, sie schrieb jedenfalls an die Zeitung Sowetskaja Kalmykija. Wie auch immer, sie fand seine Verwandten. Unter anderem seine ältere Schwester. Sie sammelten Geld für ihn, das muss man sich mal vorstellen — 1998 oder 1999, sie sammelten also Geld, um ihn dorthin zu schicken. Sie überreichten ihm das Geld, er versoff es und fiel ins Delirium.
Die Schüler schoben auf der Sanitätsstation Wache, damit er nicht erneut abhaute, bis sie ihn wieder halbwegs zur Vernunft gebracht hatten. Sie holten ihn aus diesem Wahn heraus. Dann sammelten sie wieder Geld. Die Lehrerin fuhr diesmal selbst mit. Es stellte sich heraus, dass es wirklich seine Familie war, und er blieb dort. Vielleicht kein Happy-End wie im Film — aber doch ein bisschen [in die Richtung].
Dann war da die Arbeit einer gewissen Aksinja Kosalupenko. Ihr Großvater sammelte Tschastuschki [kurze, oft von schwarzem Humor geprägte Spottlieder]. Die Arbeit hieß „Leben und Tod des Sowchos ‚Svobodny‘ in den Tschastuschki seiner Bewohner“. Es ging im Jahr 1917 los, mit Liedern über Trotzki, [und weiter] fast bis zum heutigen Tag. Darunter waren auch ganz furchtbare. Ein einziges dieser Liedchen genügt, um sich ein Dorf in der Nachkriegszeit vorzustellen.
Ich erinnere mich sogar:
Hallo Kleine!Mama, Papa!Auf zwei Beinen kommen drei wieder,über die Faschisten Sieger.
Dabei geht es übrigens um echte Menschen, denn solche Tschastuschki sind immer aus dem Dorfleben gegriffen.
Ich könnte Ihnen noch Hunderte solcher Beispiele nennen.
Noch etwas, was die Themen angeht. Für diese Schülerinnen und Schüler war es in diesem Moment sehr wichtig zu verstehen: Was war dieses Sowjetische? Was war das für ein Leben?
Es gab zum Beispiel eine wunderbare Arbeit. Ein Mädchen hatte gesucht und gesucht in ihrer Familie — es schien nichts Interessantes zu geben, eine ganz gewöhnliche Familie. Und dann findet sie die Korrespondenz ihres Großvaters mit der Zeitung Iswestija aus den frühen 1970er Jahren. Er schreibt einen Brief an die Zeitung und empört sich, weil er ein Kriegsveteran ist, aber keine Socken kaufen kann, denn die sind Mangelware. Das sei ein Skandal und so weiter. Die Iswestija leitet den Brief ans Ministerium weiter. Und das Ministerium antwortet tatsächlich, dass die Socken- und Strumpfwarenindustrie so und so viele Socken pro Kopf produziert und dass er demnach Anspruch auf anderthalb Paar Socken pro Jahr hat. Das Mädchen liest das alles und ist völlig entsetzt — der reinste Kafka. Wir schreiben wohlgemerkt das Jahr 2007, die Sockenfrage ist längst geklärt. So eine Absurdität …
Aber die größte Absurdität ist natürlich der Terror. Da wird der Urgroßvater verhaftet, mit ihm der Großvater, alle werden verhaftet. Das Mädchen bekommt die Akte, liest und traut ihren Augen nicht, weil das alles von vorne bis hinten an den Haaren herbeigezogen ist. Sie fragt sich: „Wie kann so etwas sein? Wieso am nächsten Tag erschossen? Was ist mit Einspruch? …“ Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, der mit nichts zu rechtfertigen oder zu erklären war als mit der schrecklichen Absurdität dieses Systems.
Wenn man eine Parallel-Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schreiben müsste, dann wäre das die Geschichte des Hungers — beginnend mit dem Bürgerkrieg und im Grunde bis in die späten 1940er Jahre hinein.
Alles, was mit dem Hunger zu tun hat, ist, im Gegensatz zur Geschichte des Widerstands, sehr hart und beängstigend. Denn da gibt es keinen optimistischen Ausgang, nichts Heldenhaftes. Lidija Ginsburg beschreibt in ihrem Blockade-Tagebuch sehr gut, wie grauenhaft und unmittelbar körperlich der Hunger ist und wie schwer es ist, sich darüber zu erheben.
Ganz oft schrieben die Schüler: „Das habe ich nicht erwartet, ich sitze hier und weine.“ Das lag natürlich auch daran, dass wir sie gebeten hatten, so gut es geht ihre Selbstreflexion einzuschalten. In den Familien wurde so etwas verschwiegen, niemand redete darüber. „Ich wusste nicht, warum meine Urgroßmutter nie etwas gesagt hat. Woher kommt unser Nachname?“ Wenn sie herausfinden, dass die Nationalität nicht stimmt … kehren wir zurück zu den sowjetischen Papieren: Die Nationalität ist also falsch, der Nachname ist falsch, das Geburtsjahr auch, absolut alles ist falsch. Natürlich ist es für Schülerinnen und Schüler, für Jugendliche überhaupt, sehr schwer, das zu verstehen. Auch für Erwachsene ist das schwer.
Nach dem Jahr 2010, vielleicht sogar etwas früher, ändern sich die Vorzeichen langsam. Wir sehen, wie der Staat auf verschiedenen Kanälen in die Schulen eindringt. Einerseits ideologisch: Der Staat will wieder verehrt werden; der Krieg wird in gewisser Weise zum Hauptthema, weil sie [in den Klassen] immer gezwungen sind, etwas über diesen Krieg zu schreiben. Ängste kommen wieder hoch. Und in den Köpfen der Lehrerinnen und Lehrer entsteht über kurz oder lang völlige Verwirrung. Mit Putins Neuinterpretation der Geschichte entsteht ein neues Bild von einem starken Staat, dem Sieg und Stalin.
Und sogar unsere Besten … Bei diesem Wettbewerb machten ja durchaus die ehrgeizigen, interessierten, cleveren Schülerinnen und Schüler mit — der aktive Teil. Und plötzlich sind sie verunsichert. Wir haben viel diskutiert. Als wir sie nach Moskau zur Preisverleihung einluden — dazu sage ich später noch ein paar Worte —, haben wir danach viele Gespräche mit ihnen geführt. Und [da war] ein Mädchen, das einen sehr guten Aufsatz geschrieben hatte, deren Großmutter, glaube ich, aus der Westukraine stammte und der Großvater aus Litauen, und sie selbst kam natürlich irgendwo aus Sibirien [wohin die Großeltern verbannt worden waren]. Ich hatte das Gefühl, dass sie die Fragen sehr zögerlich beantwortete. Also fragte ich sie: „Wie denkst du denn über Stalin?“ Sie schweigt und sagt dann: „Ich denke, er war ein effektiver Manager.“ So einfach — und sie weiß nicht einmal, dass das eine ganze erfundene Denkrichtung ist.
So eine Kombination aus staatlicher Effizienz und Entfremdung … Ich sagte recht schroff: „Nun ja, in Bezug auf deine Familie war er offenbar wirklich ziemlich effizient. Unter anderen Bedingungen hätten sich deine Großeltern vielleicht nie kennengelernt und geheiratet, und du wärst nie geboren worden.“ Ich erinnere mich, dass es damals auf alle einen ziemlichen Eindruck gemacht hat. Und es hat gewirkt.
Wie ging es weiter? Die Behörden übten zunehmend Druck aus und mischten sich immer mehr ein. Nachdem Memorial [2014] zum „ausländischen Agenten“ erklärt wurde, grenzte es fast an eine Heldentat, mit uns zusammenzuarbeiten. Trotzdem kamen die Arbeiten auch weiterhin. Es waren vielleicht nicht mehr 3.000 im Jahr wie früher — immerhin hatten wir uns zum größten Geschichtswettbewerb in Europa gemausert, das Land ist ja riesig —, aber auf jeden Fall erreichten uns bis zum Schluss rund 1.500 Arbeiten pro Jahr.
Nur waren die Arbeiten nicht mehr die gleichen, denn mittlerweile diktierten die Schule und das Umfeld einen ganz anderen Blick auf die Geschichte. Deshalb hat sich unser Schülerwettbewerb … Viele Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte haben sich auf die eine oder andere Weise, ausgesprochen oder nicht, dagegen [gegen diesen Paradigmenwechsel] gewehrt. Das war dem Staat zunehmend ein Dorn im Auge. Ich glaube, deshalb war unser Wettbewerb eine der zentralen Angriffsflächen. Das wurde sogar bei der Verhandlung über die Zwangsauflösung von Memorial [2021] gesagt.
Am traurigsten war für uns die Sache mit den Lehrerinnen und Lehrern. Die taten mir sehr leid. Die Schülerinnen und Schüler natürlich auch, aber die waren noch jung, sie hatten ihr Leben so oder so noch vor sich. Aber die Lehrkräfte … das spielte sich alles vor unseren Augen ab. Ich meine diejenigen, die wirklich Geschichte lehren wollten, die Wahrheit lehren. Wir haben ja quasi noch die Überreste der „Sechziger“ miterlebt [Generation sowjetischer und ukrainischer Intellektueller, die sich während der Tauwetter-Periode gegen das rigide sowjetische System stellten und unter anderem Freiheit in der Kunst forderten]: meistens Frauen, manchmal Männer, in verschiedenen kleineren Städten. Für einige von ihnen, die ich persönlich kannte, war unser Wettbewerb überaus wichtig.
Es gab auch tragische Schicksale. Zum Beispiel im Dorf Stary Kurlak, im Gebiet Woronesh. Woher tauchte da plötzlich dieser großartige, tolle Lehrer auf? Es [erreichte uns] eine fantastische heimatkundliche Arbeit, so klug geschrieben, so tiefgründig. Sie haben fast jedes Haus im Dorf beschrieben, so viele Archive und Quellen ausgegraben. Das war so eine „kleine Heimat“, wir haben sogar einen eigenen Sammelband zu diesem Ort Kurlak herausgegeben: „Wir kommen aus einem Dorf“. Und das alles, weil der Lehrer, Nikolai Makarow, so eine Art „schwarzes Schaf“ war, wie das bei Lehrern ja häufiger vorkommt.
Ein sehr talentierter Heimatkundler, er hat einen Arbeitskreis ins Leben gerufen. Sie haben alle Preise abgeräumt, wirklich eine ganze Menge ausgegraben. Dieses Dorf hat eine sehr spannende und komplizierte Geschichte. Kompliziert, weil die Menschen sich nicht so einfach in Täter und Opfer und Denunzianten scheiden lassen, ein ganzes Geflecht von komplizierten Beziehungen kam da zum Vorschein.

Aber dann wurde die Schule, in der Makarow gearbeitet hat, geschlossen. Das gab es ja jetzt auch immer häufiger, dass diese kleineren Schulen geschlossen wurden. Außerdem kam er in Schwierigkeiten wegen der Zusammenarbeit mit uns und wegen der Sachen, die er seinen Schülerinnen und Schülern beigebracht hatte.
Und was ist die Antwort der Russen auf alle Probleme? Alkohol, natürlich. Der Rest liest sich wie ein Drama … Es ging immer weiter bergab, er war einsam, lebte, soweit ich weiß, nur mit seiner Mutter zusammen. Der Wettbewerb war sein ganzer Lebensinhalt gewesen. Und schließlich brannte sein Haus ab, unter welchen Umständen auch immer, er starb jedenfalls. Dabei war das der beste Lehrer unseres Wettbewerbs.
Aber ich sage noch einmal, es gab Lehrerinnen und Lehrer, die fast bis zum Schluss an unserer Seite geblieben sind. Selbst als Memorial offiziell aufgelöst worden war, kamen noch hundert Arbeiten nach. Ich kann das Bild hier natürlich nur skizzieren, aber in unserem Wettbewerb zeichnete es sich ziemlich deutlich ab. Wenn man mit Jugendlichen zu tun hat, wird alles sehr plastisch.
Nun muss ich ein paar Worte über unsere Gewinnerinnen und Gewinner sagen. Wir haben schnell gemerkt, dass wir keine großen Preise vergeben konnten, und so war der Hauptpreis eine Reise nach Moskau. Es war ganz wichtig für die Teilnehmenden, Gleichgesinnte zu treffen; irgendwann wurde das vielleicht sogar das Wichtigste. Wir wollten, dass sie ins Gespräch kommen, sich gemeinsam etwas ausdenken, zusammen spielen.
Und wir machten mit — es kamen immer alle jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen, um mit den Jugendlichen voller Leidenschaft über die Arbeiten zu diskutieren und Zeit mit ihnen zu verbringen, das war ihnen wichtig.
Denn was ist überhaupt das Allerwichtigste? Dass man mit Respekt behandelt wird. Das spüren Kinder und Jugendliche immer. Das ist die Hauptsache. Das macht einen Dialog, der oft nicht leicht ist, überhaupt erst möglich. Ich weiß von meinen eigenen Kindern und Enkelkindern, wie schwierig dieser Dialog sein kann.
Deshalb spielten diese Reisen nach Moskau — wir nannten das feierlich „Akademieschule“ —, diese sechs gemeinsamen Tage, eine riesengroße Rolle. Die Gewinner aus den Vorjahren kamen ebenfalls, um zu helfen.
Aber mit der Zeit wurde es immer schwieriger, wir mussten uns immer mehr verteidigen und schützen, rechneten stets mit Angriffen ganz unterschiedlicher Art. Die Atmosphäre wurde immer angespannter.
Wenn man an unsere Anfänge zurückdenkt — und Memorial hatte es von Anfang an nicht leicht —, ist es jetzt kaum vorstellbar, dass Ella Panfilowa auf die Bühne kommt, ich glaube, das war 2002, und sagt: „Liebe Schülerinnen und Schüler, verehrte Mitarbeiter von Memorial, ihr seid alle ganz großartig! Auch meine ganze Familie war Repressionen ausgesetzt, meine Großmutter, mein Großvater …“ Das kann man sich heute unmöglich mehr vorstellen.
Was ist aus ihnen geworden, all den 50.000 Jugendlichen, die an unserem Wettbewerb teilnahmen? Eine der besten Juristinnen von Memorial — das ist schon so ein alter Hut —, war die Gewinnerin des zweiten Wettbewerbs. Dann ist da noch Margarita Sawadskaja, eine berühmte Soziologin — ich glaube, auch aus unserem zweiten Wettbewerbsjahr. Es gibt natürlich auch ganz andere Geschichten, aber selbst die beweisen, dass wir sehr talentierte Gewinnerinnen und Gewinner hatten, dass wir uns nicht geirrt haben — nur, dass sie ihre Talente jetzt in einer gänzlich anderen Richtung einsetzen.
Zum Schluss möchte ich sagen, dass wir uns immer um internationale Kontakte bemüht haben. Heute ist es schwer vorstellbar, dass polnische Schülerinnen und Schüler in eine Moskauer Schule kommen und alle zusammen nach Mednoje fahren. Das ist wie Katyn ebenfalls ein Ort, an dem polnische Offiziere ermordet wurden. Damals kamen die Jugendlichen ins Gespräch, verglichen Biografien, redeten darüber, was das Sowjetregime einst über Polen gebracht hatte – sie sprachen die absolut gleiche Sprache. Ja, das kann man sich heute in unserer Heimat nicht mehr vorstellen.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Wie die Presse zur offensten und verlässlichsten Quelle über die Geschichte der sowjetischen Straforgane wurde.

Die Arbeit im Archiv nimmt in meiner Tätigkeit natürlich eine zentrale Stelle ein, weil ich mich mit der Geschichte der UdSSR beschäftige. Sehr vieles ist hier naturgemäß im Archiv verborgen.
Aber wenn ich daran zurückdenke, wie wir Geschichte vor 1991 erforschten, als die Archive für das breite Publikum geschlossen waren … In den Archiven arbeiteten zwar auch Menschen, Wissenschaftler, aber das waren die „richtigen“ Wissenschaftler, die die „richtigen“ Themen erforschten.
Wenn sich jemand offiziell mit sowjetischer Geschichte auseinandersetzte, als Student und später dementsprechend als Mitarbeiter irgendeines historischen Instituts, konnte er sich nicht einfach ein Thema aussuchen wie, sagen wir mal, Das geistige Erbe Trotzkis, oder ein Thema, das mit den Repressionen von 1937/38 zu tun hatte. Das wäre einfach untersagt worden, niemand hätte ihm erlaubt, sich damit zu beschäftigen.
Diese Leute mussten außerdem ausgebildete Historiker sein. Einfach von der Straße weg kam niemand ins Archiv. Als ich anfing, mich mit Geschichte zu beschäftigen, war die Arbeit im Archiv für mich etwas Unerreichbares. Das war 1975 und ist lange her, aber schon davor habe ich Zeitungen gesammelt.
Ich habe an der Chemisch-Technologischen Mendelejew-Universität in Moskau studiert, mein Fachgebiet war die Physikalische Chemie, ich erforschte Technologien für seltene und diffuse Elemente: Uran, Plutonium und alles, was unmittelbar mit der Atomindustrie zusammenhing.
Geschichte war einfach ein Hobby, das irgendwann zu meinem Beruf wurde. Ich höre manchmal: „Er hat sich selbst zum Historiker erklärt.“ Aber in Wirklichkeit werden doch die Historiker, die es werden wollen.
Es begann damit, dass ich alte sowjetische Zeitungen las, sie eröffneten mir eine ganze Welt. Die sowjetische Geschichte war ja durch und durch falsifiziert und voller Tabus. Aber das war das Romantische an der Beschäftigung mit Geschichte zu Sowjetzeiten: Du erforschst das Unbekannte, beschäftigst dich mit Dingen, die man vor dir versteckt.
Damals konnte ich nicht davon träumen, irgendwann ins Parteiarchiv zu gehen, sozusagen die Tür aufzutreten und zu sagen: „So, wo sind hier die Politbüro-Protokolle? Lasst mich mal sehen!“
Dennoch möchte ich behaupten, dass meine Studien recht erfolgreich waren. Die sowjetischen Zeitungen boten reichhaltiges Material, um die aktuellen Ereignisse zu erfassen. Die Darstellung war natürlich ideologisch geprägt, aber gewisse politische Akteure waren, zumindest solange sie nicht als Volksfeinde gebrandmarkt worden waren, solange sie zum Zentralkomitee und zum Politbüro gehörten, durchaus in den Zeitungen präsent — in Form von Porträts, Reden und ihrer Sicht auf Ereignisse, an denen sie beteiligt waren. Erst im Zuge der Repressionen von 1937/38 wurden ihre Namen vollständig aus der Geschichte getilgt. Das ist auch einer meiner Kritikpunkte an sowjetischen Lehrbüchern: Menschen kamen darin kaum vor.
Anders als in Orwells 1984 hatte die Sowjetmacht die alten Zeitungen nicht umgeschrieben. Sie hatte sie einfach in den Lesesaal der Lenin-Bibliothek gelegt, wo sie immer noch lagen. Und so waren mein Freund Sergej Filippow und ich erstaunt, als wir den Lesesaal in Chimki [Vorort von Moskau] betraten und Zeitungen zu sehen bekamen, in denen es Fotos von [Genrich] Jagoda [dem 1938 hingerichteten Chef von Geheimpolizei und Innenministerium] und einen Bericht über den Prozess gegen den trotzkistisch-sinowjewistischen Block im August 1936 gab. Damals wurde uns klar, dass es genau das war, was wir studieren müssen, um wirklich historisches Wissen zu erlangen.
Die Sowjetmacht maß der Presse eine herausragende Bedeutung bei, wie man unter anderem an Lenins Parolen sah: „Die Presse ist nicht nur ein kollektiver Agitator, sondern auch ein kollektiver Organisator“. Die sowjetischen Behörden sorgten dafür, dass in jedem Bezirk eine eigene Zeitung herausgegeben wurde.

Ich wusste relativ schnell, dass ich mich auf die Geschichte der sowjetischen Sicherheitsorgane konzentrieren will. Und die Zeitungen auf Bezirks-, Stadt-, regionaler und Landesebene lieferten hierzu reichlich Material, denn die Namen der Akteure waren überall zu lesen. Sie wurden entweder ausgezeichnet oder ermutigt oder standen [bei Veranstaltungen] auf dem Podium. Ich habe ellenlange Register mit den Namen dieser Menschen erstellt, in dem Wissen, dass ich etwas aufdeckte, was vor mir noch nie jemand zusammengetragen hatte. Diese Romantik der Entdeckung, dieses Eintauchen war für mich sehr aufregend, ich war damals einfach glücklich.
Warum beschäftigte ich mich ausgerechnet mit diesen Menschen? Ich war natürlich alles andere als zufrieden mit den sowjetischen Lehr- und Geschichtsbüchern, die mir nichts über [Geheimdienstchef] Lawrenti Berija erklärten, obwohl sein Name in aller Munde war. Selbst [der Liedermacher Wladimir] Wyssozki sang einmal: „Sie holen unseren Nachbarn ab, weil er aussieht wie Berija.“ Berija war so ein Negativheld aus dem Lehrbuch, ein Sündenbock, den die Sowjetmacht auserkoren hatte, um ihm alle Gräueltaten zuzuschieben, die in Wirklichkeit von Stalin ausgingen.
Es war ein äußerst wichtiges Thema, das zum einen geheimnisumwoben war, und zum anderen ging es um echte Menschen. Drittens wollte ich unbedingt wissen, wer dieser Berija war, wenn die Zeitungen „Berja und seine Bande“ schrieben. [Die Antwort] fand ich in einer Zeitung von 1953. Mein Vater sammelte zu Hause Zeitungen und sagte immer, es sei uninteressant, sie heute zu lesen, aber in 20 Jahren wären diese Zeitungen interessant. Und er hatte recht. Denn die Zeitungen von heute – nun ja, sie sagen das Gleiche wie im Radio und im Fernsehen. Aber dann vergehen 20 Jahre, und plötzlich stellt sich heraus, dass diejenigen, die man vor 20 Jahren gepriesen hat, nun Schurken sind, und umgekehrt.
Alles verändert sich, innerhalb von 20 Jahren kann ein ganzer Paradigmenwechsel stattfinden. So ein Wechsel lässt sich deutlich beobachten, wenn man 20 Jahre alte Zeitungen liest. Die Sowjetmacht ging wohl davon aus, dass der Sowjetmensch kein Langzeitgedächtnis besitzt. Aber sie täuschte sich, denn an Berija erinnert man sich noch immer, genau wie an diejenigen, die die Sowjetmacht verfolgt und hingerichtet hat.
Diese Kombination aus mündlicher Überlieferung und Zeitungsartikeln bot mir nun eine ganze Fülle von Material. Aber mich interessierte vor allem der Fall Berija. Wer gehörte noch dazu? Es war eine Suche nach Menschen, deren Nachnamen den meisten Sowjetbürgern unbekannt waren … Merkulow, Dekanosow, Kobulow, Goglidse, Meschik. Was waren das für Leute? In der Zeitung von 1953 konnte man nachlesen, welche Posten sie innehatten. Zum Beispiel war Meschik der Leiter einer der NKWD-Direktionen, so stand es dort, glaube ich, geschrieben. Ich dachte mir also: Wenn ich alle regionalen Zeitungen durchsehe, werde ich ihn sicher finden.
So entstand mein großes Projekt. Ich durchsuchte sämtliche regionalen Zeitungen, alle Listen mit den Mitgliedern der Regionalräte und Regionalkomitees. Meschik war nicht auffindbar. Dafür eine Menge anderer Namen von Führungspersonen, die später Generäle wurden. Ich fand lange Auszeichnungslisten: Titel, Nachname, Vorname, Vatersname, Art der Auszeichnung und Abteilung.
Wenn zum Beispiel ein gewisser Podolitschew in seinen Memoiren seine Zeit als erster Sekretär des Jaroslawler Regionalkomitees beschrieb und die Nachnamen der Mitglieder des Präsidiums aufzählte, nahm ich mir einfach die Jaroslawler Zeitung Sewerni Rabotschi und fand dort Berichte zum regionalen Parteitag. Dort waren die Mitglieder des Regionalkomitees abgedruckt, samt Initialen.
Wenn man mehr herausfinden wollte – ich kenne zum Beispiel Nachnamen, Vornamen und Vatersnamen, interessiere mich aber auch für den Lebenslauf –, ließ sich der Code ebenfalls leicht knacken. Man musste einfach den Zeitabschnitt nehmen, in dem der Regionalrat gewählt wurde: Die Parteispitzen waren dort meistens vertreten. In den Listen der Regionalräte war dann schon das Geburtsjahr genannt. Dann sah man nach, in welchem Kreis derjenige zur Wahl aufgestellt wurde. Wenn das ein kleiner, eher ländlicher Kreis war, dann hatte man den Jackpot [geknackt]. Dann besorgt man sich einfach die regionale Zeitung und hat seine Biografie samt Foto.
Ganz zu schweigen davon, dass alle überregionalen, aber auch regionalen Zeitungen Nachrufe abdruckte, wenn jemand gestorben war. Und wenn jemand einfach ohne Nachruf verschwand, sagte das auch viel aus. Was war mit ihm passiert? 1937/38 war die regionale Presse dabei äußerst offenherzig. Sie bezeichnete die verhafteten Polibüro-Mitglieder geradewegs als Volksverräter. Sie stigmatisierte sie also, und die Stigmatisierung jener Jahre ist auch sehr interessant, weil sich schon dadurch ein kollektives Bild der regionalen Führung ergab.
Auf landesweiter Ebene war alles noch einfacher, weil die Mitglieder des Politbüros in der Öffentlichkeit standen. Wenn zum Beispiel am Vorabend des Jahrestags der Oktoberrevolution 1982 die Porträts von [Politbüro-Mitglied Andrej] Kirilenko nicht aufgehängt wurden, wussten gleich alle Bescheid. Dann hieß es: „Das war’s also, der ist weg vom Fenster.“ Und tatsächlich: Ein paar Wochen später gab es ein Plenum, und Kirilenko wurde aus dem Politbüro entfernt.
Als ich 1988 zu Memorial kam, verfügte ich über etwa 500 Biografien führender Tschekisten [Geheimdienstmitarbeiter]. Ich hatte über 3.000 Namen in einem Notizbuch gesammelt und die entsprechende Abteilung vermerkt. Außer den 500 hatte ich auch Kurzbiografien zu anderen Persönlichkeiten. Ich kam also nicht mit leeren Händen zu Memorial.
Als ich Arseni Borissowitsch Roginski [einen der Mitgründer von Memorial] kennenlernte, war er beeindruckt von meiner Arbeit. Er sagte: „Natürlich brauchen wir diese Arbeit bei Memorial, du musst aufhören, im Untergrund zu arbeiten. Warum hockst du dort und machst das heimlich?“ Dann kam auch schon 1991 mit der Archiv-Revolution, und die Archive wurden geöffnet.
Ich war überrascht, wie viele Unterlagen über kriminelle Handlungen die sowjetischen Behörden in den Archiven aufbewahrten. Was das Personal der sowjetischen Staatssicherheitsbehörden betrifft, so hatte ich das Grundgerüst im Wesentlichen bereits zusammengetragen, in den Archiven fand ich nur zusätzliche Daten.
Aber was den Inhalt anbelangt: Die Geschichte der Repressionskampagnen und konkreter Verbrechen, die geheimen Morde — die Akribie, mit der das alles in den Archiven festgehalten worden war, erstaunte mich. Die Art, wie die sowjetischen Behörden das alles gesammelt hatten. Viele Leute haben mich später gefragt: „Warum haben sie es denn nicht vernichtet?“ Und ich antwortete mit den Worten Lenins: „Der Sozialismus ist Bürokratie.“ Wie sollte man sonst kontrollieren, wer wofür verantwortlich war, wer belohnt und wer bestraft werden sollte? Dafür muss es Dokumente geben. Und diese Dokumente wurden aufbewahrt.
Das war natürlich ein Wendepunkt. Ich konnte meine Arbeit endlich mit handfestem historischem Wissen füttern.
Der August 1991 brachte die ganze Archivwelt in Bewegung. Es wurde eine Kommission für die Übernahme und Überführung der KPdSU- und KGB-Archive in die staatliche Aufbewahrung unter der Leitung [des Historikers Dmitri] Wolkogonow eingerichtet. Ich war als Sachverständiger Teil der Kommission.
Ich sprach damals mit Bukowski, und er schlug vor, eine internationale Archivkommission zu gründen, die alle sowjetischen Archive, die bis dahin verschlossen und unzugänglich gewesen waren, in die Hand nehmen, veröffentlichen und untersuchen sollte, damit die Vergehen endlich aufgedeckt und die Täter bestraft werden konnten.
Aber als dieser Entwurf abgetippt war — ich war dabei, ich habe zusammen mit Bukowski die handschriftliche Version geschrieben —, kurz gesagt, als Bukowski mit diesem Vorschlag in den Kreml spazierte, wurde er abgelehnt. Überall bekam er zu hören: „Das ist demütigend, wir können unsere eigene Geschichte doch wohl selbst aufarbeiten. Wozu brauchen wir all diese Universitäten in Cambridge, Oxford, Stanford und Columbia?“ Er erwiderte: „Aber diese Leute haben bereits Erfahrung, sie haben lange studiert, und es gibt ja auch hier im Land Menschen, die beteiligt wären, zum Beispiel Memorial.“ Aber natürlich wurde er abgewiesen.
Der Rest ist schnell erklärt. Wer kam 1991 an die Macht? Im Prinzip derselbe Apparat, nur dass es die unteren und mittleren Ränge der KPdSU waren. Wie sich herausstellte, waren sie nicht in der Lage, über diese Hürde zu springen und zu sagen: Wir sind das neue demokratische Russland, wir müssen die Lustration ausrufen und unsere Vergangenheit hinter uns lassen. Stattdessen begannen sie, Elemente dieser Vergangenheit für sich zu nutzen, und schon Mitte der 1990er Jahre hatte sich der sowjetische Traditionalismus im Grunde genommen durchgesetzt. Der ganze Rausch der Perestroika und der Post-Perestroika-Zeit des demokratischen Russlands — all das ging den Bach runter.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Wie Archivdokumente verhinderten, dass sich ehemalige Tschekisten als Opfer darstellen konnten.

Wissen Sie, man kann niemandem in den Kopf kriechen und genau sagen, ob er sich selbst hinterfragt, und inwieweit er das, was er tut, reflektiert. Die Tschekisten [Geheimdienstmitarbeiter], mit denen ich Anfang der 1990er beziehungsweise in den späten 1980er Jahren geredet habe, waren für mich genau aus diesem Grund interessant. Was hätten sie mir zu sagen, wie dachten sie?
Natürlich sagten die meisten, sie hätten dies und das nicht gewusst, würden sich an dies und jenes nicht erinnern, hätten „nur Papiere hin und her geschoben“. Aber als ich später Zugang zu den Archiven bekam und ihre Schicksale und Geschichten anhand der Dokumente nachvollziehen konnte, wurde mir klar, dass in den Interviews absolut alle gelogen hatten. Die einen eben mehr, die anderen weniger.

Leonid Fjodorowitsch Raichman, ehemaliger Generalleutnant beim Ministerium für Staatssicherheit (MGB), selbst Opfer von Repressionen, sagte am Telefon zu mir: „Ach, Sie sind dieser Sonderling, der sich für uns interessiert?“ Als ich ihn nach verschiedenen Dienstgenossen ausfragte, war er irritiert, dass ich ihre Namen kannte, als wäre ich selbst dabei gewesen. Da wurde es plötzlich für ihn selbst interessant. Es ging nicht mehr bloß darum, etwas vor mir zu verbergen oder seine eigene Interpretation der Ereignisse zu liefern. Er fragte sich, wie viel ich wohl über sie alle weiß. Er fing quasi an, sein professionelles Tschekistenspiel zu spielen.
Die Führungsriege der Tscheka [Geheimpolizei der Sowjetunion 1917–1922] hatte so etwas wie einen wiedererweckten Opferkomplex: „Wir haben treu und ergeben der sowjetischen Macht gedient. Ihre Befehle ausgeführt. Die Befehle waren nicht gut. Aber uns hat man auch nicht gerecht behandelt.“ Und so weiter und so fort. Das heißt, eine echte, bewusste Reue, die wir als moralische Reinigung bezeichnen könnten, fand nicht statt.
Es gab auch Leute wie Pawel Sudoplatow, die weiterhin stur all die Undinge rechtfertigten, die sie getan hatten. Sie waren der Meinung: „Ich bin ein lästiger Zeuge. Der Staat ließ mich Menschen umbringen, und dann bestrafte er mich dafür. Das ist ungerecht.“
Ich habe mich eingehend mit Sudoplatow beschäftigt. Ich habe viele Dokumente gesehen, von denen er angenommen haben muss, dass sie nicht mehr existierten. Auf meine ersten Veröffentlichungen – ich hatte in der Zeitung Moskowskije Nowosti [Moskauer Nachrichten] gemeinsam mit Natalija Geworkjan über Sudoplatows „Heldentaten“ geschrieben – reagierte er, das war noch zu seinen Lebzeiten, ziemlich nervös.
Was war das Problem? Er hat lange für seine Rehabilitierung gekämpft. Den Boden dafür bereitet. Er arbeitete [dem Militärhistoriker Dmitri] Wolkonogow zu, der ein Buch über Trotzki schrieb. Dabei muss ihm bewusst gewesen sein, dass da Dinge auf ihm lasteten, die seine Rehabilitierung im kollektiven Bewusstsein unmöglich machten. Also schrieb er sozusagen mit der einen Hand weiterhin Anträge an das Zentralkomitee, an die Staatsanwaltschaft, an einflussreiche Leute, um seine Rehabilitierung zu erreichen, während er mit der anderen Hand eifrig an seinen Memoiren arbeitete. Er wusste, dass eine Rehabilitierung in der Öffentlichkeit ihm helfen würde, die angestrebte juristische Rehabilitierung zu erreichen.
Juristisch wurde Sudoplatow Anfang 1992 rehabilitiert, als das neue Rehabilitierungsgesetz verabschiedet wurde. Allerdings stand dies in krassem Widerspruch zu einem Gesetz, das die Rehabilitierung von Personen verbietet, die eine Straftat gegen die Verfassung begangen haben. Sudoplatows Akte ist voll von solchen Straftaten.
Die Entscheidung über seine Rehabilitierung 1992 wurde nicht von einem Staatsanwalt der zuständigen Abteilung der zentralen Militärstaatsanwaltschaft unterzeichnet, sondern von einem Staatsanwalt der Abteilung zur Aufsicht über die Staatssicherheitsorgane – das heißt von einer Person aus Sudoplatows eigenem Umfeld. Das verstieß gegen sämtliche Vorschriften.
Als ich später mit den Mitarbeitern der Rehabilitierungsabteilung sprach, sagte mir der Leiter dieser Abteilung, Kupez, die Entscheidung sei an ihnen vorbei getroffen worden, sie würden versuchen, sie anzufechten. Aber das ist ihnen natürlich nicht gelungen.
Mit seinen Memoiren hat Sudoplatow seinerseits eine Art Selbstrechtfertigung verfasst, übrigens nicht ohne die Geschichte neu zu schreiben. Er verschweigt darin vieles, biegt sich diverse Ereignisse zurecht. Das ist Fakt. Aber vor allem rechtfertigt er alles mit der Bedeutung des öffentlichen Dienstes. Er hat den neuen Zeitgeist sehr genau erfasst: Partei ist Partei, aber ich habe grundsätzlich immer meinem Heimatland gedient, dem Staat. Deshalb sind seine Memoiren, wenn man genau darüber nachdenkt, die Memoiren eines uneinsichtigen Verbrechers.
Sein Sohn Anatoli, der leider früh verstorben ist, hat jeden verklagt, der seinen Vater, Pawel Sudoplatow, als Verbrecher bezeichnete. Nur mich nicht. Er verstand sehr gut, dass meinen Überzeugungen Dokumente zugrunde liegen, die da heißen: Fonds, Verzeichnis, Akte, Blatt. Dies und das Wissen um die Fadenscheinigkeit der erfolgten Rehabilitierung geboten es ihm, mit diesem Thema nicht unnötig hausieren zu gehen.
Sudoplatows Archiv- und Ermittlungsakte, die der Staatsanwaltschaft vorliegt, enthält mindestens vier Fälle, in denen er 1946 und 1947 unter Umgehung des Gerichts und der sowjetischen Gesetze Menschen getötet hat.
In einem Fall gab Sudoplatow den Befehl, eine tödliche Spritze zu verabreichen, während er unmittelbar neben dem Opfer stand. Als [der ukrainische Sozialrevolutionär] Schumski 1946 ermordet wurde, war Sudoplatow mit in dem Zugwaggon [in dem das passierte]. Diese Fälle sind unter anderem in meinen Artikeln detailliert dokumentiert.
1941 hatte Stalin die Idee, eine spezielle Gruppe im NKWD [Innenministerium und Geheimpolizei der UdSSR 1934–1946] zu schaffen, die sich mit Menschen befassen sollte – ich zitiere Stalin –, „die wir nicht verhaften können, die uns jedoch schaden. Deshalb müssen diese Leute entführt, geschlagen und liegen gelassen werden.“ Implizit war das natürlich ein Freibrief, jemanden, wenn es sein muss, zu töten. Sudoplatow übernahm 1941 den Vorsitz dieser Sondergruppe.
Nach dem Krieg hat niemand dieses Thema vergessen: jemanden im Land zu vernichten, auch wenn es keinen Anlass gibt oder zu kompliziert ist, ihn zu verhaften. In seinem Buch schreibt Sudoplatow bemerkenswerterweise, er habe „von vier solchen Fällen gewusst“. 1946 wurde auf diese Weise der polnische Ingenieur Samet ermordet, bevor er nach Polen zurückkehren konnte. Sie ließen ihn nicht gehen, weil seine Arbeit mit dem Militär zu tun hatte, er soll an einem Projekt für die U-Boot-Flotte beteiligt gewesen sein. Er wurde einfach liquidiert – nach einem Plan, den Sudoplatow ausgearbeitet hatte. Dieser Plan wurde vom Minister [für Staatssicherheit Viktor] Abakumow abgesegnet und dementsprechend von Stalin und seinem inneren Kreis gebilligt.
Der zweite Fall: Im selben Jahr wurde der Ukrainer Schumski ermordet, der zunächst den linken Sozialrevolutionären angehörte und in den 1920er und 30er Jahren Mitglied der ukrainischen Regierung war, später für seine „nationalistischen“ Ansichten von allen Posten entfernt wurde und lange Zeit in der Verbannung verbrachte, wo von aus er Briefe an Stalin schrieb. Damit erregte er erneut dessen Aufmerksamkeit, der seine Ermordung anordnete. Schumski wurde auf einer Zugfahrt getötet.
Der polnische Ingenieur Samet bekam von Mairanowski eine tödliche Spritze verabreicht, nachdem er auf der Straße festgehalten und in ein Auto gezerrt worden war. Dann wurde er am Stadtrand von Uljanowsk aus dem Auto geworfen und überfahren. Sudoplatows ganze Ideologie ging auf Stalin zurück: Man musste es immer so aussehen lassen, als wäre es entweder ein Unfall oder ein natürlicher Tod gewesen.
Im Jahr darauf, 1947, wurde auf dieselbe Weise im Gefängnis ein US-amerikanischer Kommunist und Agent der sowjetischen Staatssicherheit getötet, der 1939 wegen des Verdachts auf Doppelagentschaft verhaftet worden war. Er stand kurz vor der Entlassung. Die US-amerikanische Botschaft war involviert, er bekam Besuch von verschiedenen Diplomaten. Aber die Sowjets wollten ihn auf keinen Fall ausreisen lassen, weil er zu viel wusste. Also setzte man ihm gleich im Gefängnis eine Todesspritze. Zu diesem Fall existieren nicht viele Dokumente, aber es gibt sie dennoch.
Im Herbst 1947 wurde ebenfalls durch eine tödliche Injektion der griechisch-katholische Bischof Fjodor Romsha ermordet, nachdem zuvor ein Attentat gegen ihn missglückt war. Er war Vorsteher der griechisch-katholischen Kirche in Uschhorod [in der Westukraine], die der vom Kreml offiziell unterstützten, wenn auch nicht besonders geförderten Kirche ein Dorn im Auge war. Auch dieser Mord war das Werk von Sudoplatows Abteilung.
Wie soll man das nennen, wenn jemand außergerichtlich, ohne jegliche Ermittlung oder Verhaftung einfach umgebracht wird, weil es die oberste Führung so angeordnet hat? Diese Episoden sind in Sudoplatows Archivakte allesamt dokumentiert und waren für ihn höchst unangenehm. Wie konnte man 1992 einen Mörder rehabilitieren? Das ist mir schleierhaft.
Ich habe versucht, Sudoplatows Rehabilitierung vor Gericht anzufechten, aber mein Gesuch wurde mit den Worten abgewiesen: „Ihre Rechte sind hier nicht betroffen. Was geht Sie das an? Wenn die Opfer selbst einen Antrag schreiben würden, dann würden wir das vielleicht prüfen. Aber Sie sind Historiker, Wissenschaftler, wie viele von Ihnen gibt es hier? Sie wollen [alle] etwas, überlasten unser Gerichtssystem mit Fällen, die Sie nichts angehen.“ So gilt Sudoplatow bis heute offiziell als rehabilitiert.
Er saß 15 Jahre im Gefängnis, wurde unter Chruschtschow verhaftet. Die Anklage lautete: „Mitglied der Bande um Berija“, die im Interesse Berijas [Geheimdienstchef bis 1953] unschuldige Menschen beseitigt haben soll. Stalins Name wurde zu Chruschtschows Zeiten weitestgehend ausgespart. Aber in diesem Fall wissen wir, dass die „Bande um Berija“ ein künstliches Konstrukt war. Sudoplatow wusste das auch. Er sagte aus: „Ich stand Lawrenti Berija nie nahe, ich habe nie auf seinen Befehl hin jemanden getötet.“
Und das war die Wahrheit. Es war wirklich nicht Berija, der ihn beauftragt hatte, all diese Menschen zu töten. Die Anordnungen kamen aus dem Kreml. Aber auch für Sudoplatow war das nur ein Vorwand, um zu sagen: „Ich werde zu Unrecht beschuldigt.“ Die 15 Jahre Gefängnis haben natürlich ihre Spuren hinterlassen. Sudoplatow überstand mehrere Infarkte und war, soweit ich weiß, auf einem Auge erblindet. Das Wladimir-Gefängnis ist wahrlich kein Sanatorium und die Haftstrafe war lang.
Vor seiner Verhaftung hatte Sudoplatow mehrere Jahre lang erfolgreich eine psychische Krankheit vorgetäuscht, bis man ihn einer Elektroschockbehandlung unterziehen wollte. Da wurde er umgehend wieder gesund. Zufällig fiel der Moment seiner Genesung auch mit der Nachricht zusammen, dass sein Stellvertreter Ejtingon nicht erschossen, sondern zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde. Das hat ihm neuen Mut gegeben, das Schlimmste schien überstanden. Die dicksten Fische hatte man beseitigt, jetzt konnte man sich irgendwie herauswinden. So kämpfte er ums Überleben.
Nach seiner Freilassung war Sudoplatow im Literaturbetrieb tätig. Er war nicht arm, verdiente gut. Er lebte von seiner Rente und dem Honorar für seine Autorentätigkeit, die gut bezahlt wurde. Ich glaube, wäre ihm bewusst gewesen, dass er in seinem früheren Leben, vor 1953, etwas falsch gemacht hatte, hätte er sich nicht um seine Rehabilitation bemüht. Aber er hatte das Gefühl, dass ihm Unrecht widerfahren war, er wollte seine Unschuld beweisen. Genau das macht ihn für mich zu einem uneinsichtigen Verbrecher. Mit einer Rehabilitierung, dachte er, ließe sich seine kriminelle Vergangenheit einfach auslöschen.
Wie viele hochrangige NKWD-Beamte wurden rehabilitiert, nur weil man sie einer angeblichen Verschwörung beschuldigt hatte? Aber niemand gab ihnen die Schuld für die Repressionen, an denen sie beteiligt waren.
Verstehen Sie, es ist doch völlig absurd, wenn die Tschekisten der 1920er und 30er Jahre und die Tschekisten der 1950er Jahre sich zwanzig Jahre später rechtfertigen: „So waren nun mal die Zeiten, so war das Gesetz.“ Wie bei Juri Trifonow in seinem Roman Das Haus an der Uferstraße: „So waren die Zeiten, gib denen die Schuld, warum gibst du sie mir? Wir waren staatstreue Bürger, wir haben nur die Gesetze befolgt.“ Das ist allein schon aus dem einfachen Grund falsch, weil es eine Verfassung gab, die all das verbot.
Mitte der 1930er Jahre, als der Große Terror begann, versuchten viele, das sinkende Schiff zu verlassen. Nur wenigen gelang es. Viele hatten vielleicht auch Angst, es zu versuchen. Ein Mitarbeiter der politischen Abteilung, ein gewisser Sidorow, täuschte beispielsweise einfach Unzurechnungsfähigkeit vor.
In manchen Ermittlungsakten finden sich Erklärungen von regionalen NKWD-Offizieren, die verstanden, wo sie hineinzogen wurden, und die keine Gewalt gegen Häftlinge anwenden wollten. So sagte einer von ihnen: „Die anderen NKWD-Mitarbeiter nannten mich deswegen ‚Mönch‘.“ Ich erinnere mich nicht an seinen Namen, aber es handelt sich um ein recht interessantes Dokument. Es gab also auch solche Beispiele.
Was macht die Archiv- und Ermittlungsakten der 1930er Jahre, die im Zusammenhang mit der massenhaften „Entkulakisierung“ stehen, so wertvoll? Als in den 1950ern von Chruschtschow die Epoche der Rehabilitierungen eingeleitet wurde, waren viele von denen, die in den 1930ern die Akten beim NKWD geführt hatten, noch am Leben und wurden oft als Zeugen verhört.
Die Ermittler der Militärstaatsanwaltschaft nahmen ihre Aufgabe durchaus ernst. Sie wollten wissen, ob eine Person, die entweder erschossen worden war oder zehn Jahre im Lager gesessen hatte, schuldig war oder nicht. Deshalb befragten sie auch die Ermittler. Wenn jemand, der den Großen Terror überlebt hat, beispielsweise aussagt, dass er geschlagen wurde, können wir den Ermittler befragen. Der muss ja wissen, ob das stimmt.
Hier kommen also die Stellungnahmen und Verhörprotokolle der ehemaligen Ermittler ins Spiel. Sie liefern ihrerseits eine Menge Material, denn der ehemalige Ermittler versucht, wenn er zur Befragung vorgeladen wird, die Schuld auf seine Kollegen abzuwälzen, nennt neue Namen, und dann wird ein neuer Fall eröffnet und so weiter. Das zieht wieder eine Fülle von Material nach sich, das uns unter anderem zeigt, wie die Fälle fabriziert wurden, oder wie bereits Verurteilte noch auf ihrem Weg zur Erschießung geschlagen wurden. So sagte zum Beispiel ein NKWD-Mann: „Gib ihm noch eine Tracht Prügel zum Abschied.“
Aber man konnte auch noch viel schlimmere Dinge dort nachlesen. Folter, völlig grundlose Misshandlungen. An den Haaren herbeigezogene Anschuldigungen, fabrizierte Fälle. Das ganze Universum der stalinistischen Willkür liegt dort vor uns ausgebreitet, der ganze Abgrund.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Die Deklaration einer Vereinigung ukrainischer Künstler und Schriftsteller von 1945 und die Geschichte dahinter.

Der Bestand Ihor Kostezky. Deklaration der Vereinigung ukrainischer Schriftsteller und Künstler „Ukrainische Künstlerbewegung“ (ukr.: „Mystezky ukrajinsky ruch“ — MUR).
Zu Beginn der 1930er Jahre fielen in der Sowjetukraine fast sämtliche Vertreter der ukrainischen Avantgarde den stalinistischen Repressionen zum Opfer: Schriftsteller, Dichter, Regisseure, Wissenschaftler. Für sie wurde später eine kollektive Bezeichnung geprägt: „Erschossene Renaissance“. Eine ganze Generation der ukrainischen Intelligenzija wurde vernichtet. Nach dem Krieg hätten alle, die im September 1945 diese Erklärung der MUR unterzeichneten, zu einer neuen kulturellen Generation werden und die Lücke füllen können, die durch diese schrecklichen Verluste entstanden war. Dem war aber nicht so …
Einige Worte über Ihor Kostezky, dessen Nachlass einen eigenen Archivbestand bildet. Er wurde 1913 in Kyjiw geboren. Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder schloss er sich Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre Gruppen der kulturellen Avantgarde an. Ungeachtet der bereits einsetzenden stalinistischen Repressionen arbeitete der junge Kostezky in verschiedenen Leningrader und Moskauer Theatern, interessierte sich für die Schule des Künstlers Pawel Filonow. Zusammen mit seinem Bruder war er an vielen Theateraufführungen beteiligt.
Ende der 1930er Jahre kehrte er nach Kyjiw zurück. Mit Beginn des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion geriet er unter das NS-Besatzungsregime und wurde zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Nach dem Krieg wurde er dort als sogenannte displaced person, als Flüchtling, in einem Lager interniert, wo er ukrainischen Landsleuten begegnete.
Das Dokument aus Kostezkys Archivbestand, das hier vorgestellt wird, besteht aus zwei Blättern schlechten, zeitungsähnlichen Papiers, das eine Gruppe ukrainischer Insassen des Internierungslagers auftreiben konnte. Darauf steht — maschinengeschrieben und in ukrainischen Lettern! — der Text einer Deklaration der Vereinigung ukrainischer Schriftsteller und Künstler, die sich „Ukrainische Künstlerbewegung“ (MUR) nannte.

Unter dem in Nürnberg verfassten und auf den 26. September 1945 datierten Text stehen die Namen von sechs Initiatoren der Deklaration (darunter Kostezky) und 35 Unterzeichnenden sowie die Originalunterschriften fast aller, die an diesem Treffen teilnahmen.
Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Als ich dieses Dokument bearbeitete, kannte ich bereits sowohl die Geschichte der „Erschossenen Renaissance“ als auch die der ukrainischen Menschenrechtsbewegung. Daher verstand ich sehr wohl, wie sehr das fast ein Ding der Unmöglichkeit war, im Internierungslager … Diese Menschen hatten schwer gearbeitet, viele von ihnen wurden krank und haben nicht überlebt. Und dann gab es diesen „Rest“: Literaten, Musiker, Künstler, Bildhauer. Ich lese da heraus, dass sie selbst noch nicht glauben konnten, dass sie überlebt hatten. Ganz Deutschland war zerbombt, in vier Besatzungszonen geteilt. In einem der Sektoren werden sie irgendwo auf Plätzen zusammengeholt, die umzäunten Stadien ähnelten, es werden schnell einige Baracken errichtet … Dort also werden diese Menschen untergebracht. Dort finden sie einander — und zwar so schnell, in solcher Euphorie, dass sie sogleich dieses Treffen organisieren. Aber wo haben sie bloß die Schreibmaschine mit ukrainischen Lettern gefunden?!
Sich vorzustellen, dass sie sich irgendwo dort auf einer Wiese versammelten … wo noch vor einem halben Jahr Krieg war, Bomben fielen, da war so etwas doch unvorstellbar. Und doch war es wieder eine Renaissance!
Anhand dieses Dokuments aus dem Kostezky-Bestand wird erkennbar, dass die Ukrainer, als sie noch im Internierungslager waren, überhaupt nicht wussten, wie sich ihre Zukunft gestalten würde. Sie fühlten sich wie eine große Familie. Sie wollten sich unbedingt vereinigen und mit ihrer künstlerischen Betätigung und ihrer Arbeit der Welt etwas vermitteln, von dem man dann sagen würde: Auch das ist die ukrainische Kultur, auch sie sind Repräsentanten dieser Kultur. Obwohl das Schicksal sie vor, während und nach dem Krieg in alle Winde zerstreut hatte, pflegten sie gleichwohl einen konstanten Zusammenhalt.
Dieses Dokument habe ich als Renaissance wahrgenommen, und als ich dazu den Kontext aufbereitete, das Datum und diese Unterschriften sah, zitterten mir wirklich die Hände. Ich schaute mir das Dokument an und wollte laut rufen: „Wo sind all die Historiker und Wissenschaftlerinnen, um das hier auszuwerten und zu begreifen, welch ein einzigartiges Dokument das ist? Ich will es allen zeigen, schaut es an!“
Ich habe dieses Dokument als Archivarin gefunden, ich bearbeite es, verstehe, was das für ein Unikat ist. Ich kann es so erschließen, dass jemand, der nach etwas in dieser Art sucht, bildlich gesprochen, unbedingt darüber „stolpern“ wird. Doch bei all meiner Beschreibung des Dokuments reichen meine historischen und literaturwissenschaftlichen Kenntnisse nicht aus, um den Kontext oder gar jedem der Namen so viel hinzuzufügen, dass ich vollständig verstünde, wie einzigartig im Quadrat dieses Dokument ist. Aber es ist wenigstens ein Pfad.
Nun, ein richtungsweisender Pfad. Wir sind zwar ein sehr kostbares Archiv, aber leider auch ein relativ junges und kleines. Wir haben nicht viele Mitarbeiterinnen. Deshalb bleibt dieses Dokument, auch wenn ich es entdeckt und begutachtet habe, intern … Denn der Bestand Kostezky umfasst rund 70–80 Kartons. Ich habe jetzt keine Möglichkeit, ihn zu bearbeiten und zu erschließen; das würde mindestens ein Jahr dauern. Daher ist er leider noch nicht erschlossen und in der Datenbank nicht enthalten. Doch jede Forscherin, die in unserem elektronischen Katalog sieht, dass es Materialien zu Kostezky gibt, und dass dort auch die Korrespondenz mit der Diaspora enthalten ist, sowie Materialien des Tamisdat [„Dortverlag“ — verbotene sowjetische Literatur, die ins Ausland geschmuggelt und hinter dem Eisernen Vorhang veröffentlicht wurde], Publikationen, Fotos …, diese Person kann daraufhin eine konkrete Anfrage stellen.
Natürlich würde ich jedem Anfragenden, bei dem ich spüre, er oder sie hat Ahnung von der Materie, dieses Unikat, verzeihen Sie den Ausdruck, unterjubeln, damit er oder sie es sich anschaut, damit arbeitet und etwas darüber publiziert.
Darin sehe ich die Aufgabe einer Archivarin: das richtige Dokument zu entdecken und es in die richtigen Hände zu übergeben.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Die Geschichte eines Briefwechsels zwischen Magadan und Bremen zur Zeit des Eisernen Vorhangs.

Vor uns liegt eine deutsche Mitteilungskarte, ein Rückschein, datiert vom Juli 1979, über die Zustellung eines Briefes oder Päckchens in die Sowjetunion, genauer: nach Matrossowo im Gebiet Magadan. Dorthin war der ukrainische Dichter Wassyl Stus verbannt worden.

Stus wurde 1938 in Winnyzja geboren und lebte einen Großteil seines Lebens in Donezk. Er war Doktorand am Kyjiwer Institut für Literatur und ging im September 1965 in die Geschichte der ukrainischen Menschenrechtsbewegung ein, als er im Kino Ukraina in Kyjiw auftrat, in dem die Premiere von [Sergej] Paradschanows „Schatten vergessener Ahnen“ [später auch: „Feuerpferde“] stattfand. Er stand auf und rief zur Solidarität mit den ukrainischen Dissidenten auf.
Im September 1972 fand der erste Prozess gegen Stus statt, der mit einer Verurteilung zu „fünf plus drei“ endete, also zu fünf Jahren Lager und drei Jahren Verbannung. Ab 1977 war sein Verbannungsort jenes Matrossowo im Gebiet Magadan.
Einige Worte über die Empfängerin des erwähnten Rückscheins, Christa Bremer: Sie war eine Frau mit einer schwierigen Biografie: 1929 in Berlin geboren, erlebte sie als Jugendliche das Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie floh aus der zerbombten und in vier politische Sektoren geteilten Hauptstadt in den Westteil Deutschlands. Anfang der 1980er Jahre lebte sie in Bremen und war eine wohlhabende Witwe, die ihr Vermögen für eine gute Sache einsetzen wollte. Eher zufällig kam sie zu einer Gruppe von Amnesty International, lernte die Leute dort kennen und wurde aktives Mitglied dieser Organisation.
Normalerweise übernehmen Aktivistinnen und Aktivisten von Amnesty für bestimmte politische Häftlinge in einem Land eine Patenschaft und unterstützen diese Menschen über viele Jahre hinweg. Christa Bremer ging auf eine Veranstaltung in einem Bremer Buchladen, bei der der Germanist, Schriftsteller und Menschenrechtler Lew Kopelew auftrat. Ihm war vor ein paar Jahren die sowjetische Staatsbürgerschaft entzogen worden. Er befand sich nun in erzwungener Emigration. Christa Bremer ging auf ihn zu und fragte, wen er in der Sowjetunion für eine Patenschaft empfehlen würde. Kopelew zögerte keine Sekunde und nannte eine Reihe von Namen ukrainischer politischer Gefangener. Der erste war Wassyl Stus.
Christa Bremer schickte sehr, sehr viele Briefe und Päckchen – wie jenes, das zu dieser Karte vom 5. Juli 1979 gehört — an Wassyl Stus, ins Lager und in die Verbannung. Und alles mit diesen Rückscheinen, auf denen kleine Zeilen auszufüllen waren: Datum und Unterschrift des Empfängers. Stus kriegte es aber hin, ganz im Geiste eines Dissidenten, trotz des beschränkten Platzes neben der Unterschrift etwas Persönliches und Informatives dazuzuschreiben. So schrieb er auf diese Karte auf Deutsch „Danke sehr!“ und dann noch „Mein Finis: 11.8.!“. Das bedeutete: 11. August, das Ende seiner Verbannung. Allem Anschein nach hat Stus vor Aufregung beim Empfangsdatum sogar fälschlicherweise 1977 geschrieben [statt 1979].

In Kyjiw herrschte zu dieser Zeit eine bedrückende Lage: Viele derjenigen, die im November 1976 die ukrainische Helsinki-Gruppe [Teil der ältesten sowjetischen Menschenrechtsorganisation] gegründet hatten, bekamen keine Gelegenheit mehr, Stus zu begegnen, weil sie selbst zu politischen Gefangenen wurden. Stus konnte nicht anders, er musste seine Brüder und Schwestern im Geiste einfach unterstützen. Im Herbst 1979 schloss er sich der Helsinki-Gruppe an. Aber bereits im Frühjahr 1980 wurde er erneut verhaftet. Im September 1980 wird das Urteil gefällt: zehn plus fünf, zehn Jahre Lager und fünf Jahre Verbannung.
Die letzte Phase seines Lebens verbrachte Wassyl Stus im Lager Perm-36, das wegen der schweren Bedingungen dort einen fürchterlichen Ruf hatte. Christa Bremer gelang es trotz aller Anstrengungen nicht, den Kontakt zu Wassyl Stus wiederherzustellen. Am 4. September 1985 starb Stus unter ungeklärten Umständen in einem Kerker des Lagers.
Warum ich gerade diese Karte hervorhebe? Weil Stus in meinen Augen ein völlig untypischer Dissident war. In Wirklichkeit war er ein äußerst begabter, philosophischer Dichter. Er hatte nichts Politisches an sich, nach dem Motto: „Stürzt das Regime“ und so weiter.
Ich würde es so sagen: In jeder kulturellen Gemeinschaft oder jedem Volk gibt es einen Menschen, der alle Grenzen überschreitet: einen ungewöhnlichen Menschen, der mit seinem ganzen Lebenslauf und seinem Werk, und mit all dem, wie er lebte, in die Geschichte einging. Für Stus stand wohl, im philosophischen und weltanschaulichen Sinne, der Mensch an erster Stelle, die Freiheit, die Unabhängigkeit, das Denken, und erst dann kam alles andere.
Er war ein ukrainischer Junge, wuchs mit der ukrainischen Kultur auf, allerdings in Donezk, im Gebiet Donezk. Seine Kindheit fiel in die Nachkriegszeit. Das war eine Zeit totaler Russifizierung. Ich sage das, weil mein Vater mit seinen deutschen und mennonitischen Wurzeln ebenfalls im Gebiet Donezk aufwuchs, in einer mennonitischen Kolonie. Alle Erzählungen unserer engen Freunde, die im Gebiet Donezk oder in Donezk lebten, bestätigten das. Zum einen war nach dem Holodomor [der Hungerkatastrophe mit Millionen Toten aufgrund der erzwungenen Kollektivierung der Landwirtschaft], nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Deportationen und all dem anderen von der ursprünglichen lokalen Bevölkerung kaum jemand übrig geblieben. Wer aber dort lebte oder arbeitete, bildete gleichsam die neue Generation der jungen, sowjetischen Nachkriegsukraine; das war nicht nur Russifizierung, sondern eine massive Sowjetisierung.
Stus hat all das nicht akzeptiert. Weil seine Eltern ihm die ukrainische Kultur vermittelt hatten und ihn in diesem Sinne erzogen — eine Kultur, die in seiner Umgebung fehlte. Er trug sie einfach in sich. Er bewahrte und bereicherte die ukrainische Sprache. Literaturwissenschaftler grübeln bis heute, wie ihm das gelingen konnte. Woher nur und wie fand dieser junge Mann aus dem Gebiet Donezk für sich diese Sprache, die er bewahrte und weiterentwickelte und in der er lebte? Seine Lyrik ist sehr komplex.
Aus Memoiren, aus Erinnerungen von Freunden und Kollegen geht hervor, dass viele von ihnen nicht wollten, dass Stus öffentlich protestiert und als Dissident auftritt. Sie sagten oft zu ihm, er solle auf sich aufpassen; einen wie ihn gebe es nur wenige. Er würde der ukrainischen Kultur mehr geben können, wenn er in Freiheit ist, und nicht im Gefängnis. Stus aber… Er war sogar gekränkt: Wie soll das gehen, ohne ihn?
So war es auch vor seiner letzten Verhaftung, als sich herausstellte, dass fast alle Organisatoren und Begründer der Helsinki-Gruppe in Kyjiw schon einsaßen. Nur Petro Hryhorenko war emigriert. Stus war gerade mal ein halbes Jahr zuvor aus der Verbannung gekommen. Man bekniete ihn zu warten, bis jemand gefunden werde, der die Gruppe vertritt. Aber nein, Stus antwortete: „Wie denn, ohne mich? Ich trete ein.“ Er konnte nur wenige Monate in der Helsinki-Gruppe aktiv sein, dann wurde er erneut verhaftet.
Die größte Tragödie besteht jedoch in etwas anderem. Als Stus im Gefängnis saß, erst in Kyjiw, dann in Moskau, schrieb er viele Hefte mit Übersetzungen und Kommentaren zu Rilke, mit Verweisen und Reflexionen. Das alles wurde vom KGB konfisziert. Bis heute behaupten sie dort, dass sie diese Hefte nicht haben. Der KGB in Kyjiw hat seine Archive geöffnet, dort waren die Hefte nicht. Das bedeutet, dass die Hefte beim KGB, sprich: beim FSB in Moskau sind. Die geben das aber nicht zu. Dabei erinnere ich mich, wie Kopelew zu Perestroika-Zeiten davon sprach, dass man jetzt nicht im politischen Sinne diskutieren solle, ob das nun gut oder schlecht gewesen sei. Der Koffer mit den Heften müsse bitte einfach freigegeben und dem Weltliteraturerbe überlassen werden, weil dort Perlen schlummerten. Es gab jedoch keinerlei Reaktion.
Darüber hinaus wurde Stus wohl 1977 in den internationalen PEN-Club aufgenommen, und zwar nicht als politischer Häftling, sondern als herausragender Dichter. Bis 1985 versuchte Kopelew, Stus mit Hilfe von Heinrich Böll auf die Liste der Nachfolgekandidaten des Präsidenten des Internationalen PEN-Clubs zu bekommen. Er stand nicht ganz oben auf der Liste, eher auf Platz sieben oder acht, galt aber auch als einer der Kandidaten für den Literaturnobelpreis.
Es gibt gewisse Kategorien, denen Menschen zugeordnet werden. Stus jedoch lässt sich keiner zuschreiben. Christa Bremer hat das wohl menschlich, im Herzen, gespürt. Er schrieb ihr seine Briefe auf Deutsch. Aus den Briefen und Karten all dieser Jahre wird deutlich, dass die Hilfe für andere politische Gefangene pragmatisch war: warme Socken, Schokolade. Für Stus waren es Bücher. Er nannte konkrete Autoren oder Titel, die Christa Bremer in Deutschland wohl nie gelesen oder in der Hand gehabt hatte. Für ihn jedoch fand sie die Bücher und schickte sie ihm.
Und sie bombardierte das sowjetische Ministerium für Post und Fernmeldewesen buchstäblich mit Forderungen, dass man nachforschen solle, wo dieses oder jenes Päckchen geblieben sei, warum es verloren ging. Das sei sehr, sehr wichtig. Und wenn es nicht zugestellt werden könne, solle es einfach zurückgeschickt werden.
Deshalb ist auf dieser Karte allein schon der Umstand wichtig, dass Stus das Jahr verwechselte und 1977 statt 1979 schrieb: Wir können also nur ahnen, wie aufgeregt er war. Er wollte Christa unbedingt mitteilen, dass es nur noch ein Monat ist, bis er freikommt. So viel Energie steckt in dieser Karte und in den paar Worten!
Es ist so bewegend, wie er sich auf dieses Datum vorbereitete. Und wie natürlich auch seine Freunde und seine Familie in Kyjiw bangten, genau wie Christa Bremer hier in Deutschland. Das alles spüre ich — es ist alles in dieser kleinen Postkarte konzentriert.
Umso mehr, wenn man bedenkt, dass das im sogenannten Kalten Krieg war. Schaut man sich dann noch die Landkarte an, versteht man, welch langen Weg die Karte genommen hat: Sie gelangte aus Bremen ins Gebiet Magadan, wurde dort von Stus unterschrieben und kehrte nach Bremen zurück! Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, diese rosa Karte mit den handschriftlichen Vermerken von Wassyl Stus in den Händen zu halten.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Die Sammlung der Dia-Filme von Familie Sokirko: eine einzigartige Quelle zum Leben und zur Geschichte fast aller Regionen der Sowjetunion in den 1980er Jahren.

Einige Worte zur Biografie von Viktor Sokirko, der 1939 in Charkiw geboren wurde und 2018 in Moskau starb. Er war ein sowjetischer Ingenieur und Wirtschaftswissenschaftler, war Teil der Bürgerrechtsbewegung sowie Autor und „Propagandist“ beim Samisdat.
Er absolvierte die Moskauer Technische Hochschule (MWTU) und arbeitete im Forschungsinstitut für Maschinenbau im Ölsektor. Die Materialien, von denen hier die Rede sein wird, waren oft in Umschläge aus der Verwaltung dieses Instituts eingeschlagen.
1973 wurde er wegen Aussageverweigerung im Verfahren gegen Pjotr Jakir und Viktor Krassin zu sechs Monaten Besserungsarbeit verurteilt. Ende der 1970er Jahre gehörte er zur Redaktion der Samisdat-Zeitschrift „Poiski“ („Die Suchen“) und gab im Samisdat unter dem Pseudonym K. Burschuademow („Bourgeois-Demow“) Sammelbände über die Verteidigung wirtschaftlicher Freiheiten heraus. 1980 wurde er wegen Beteiligung an diesen Samisdat-Projekten zu drei Jahren Freiheitsentzug auf Bewährung verurteilt. Von 1989 bis 2001 war er Vorsitzender der „Gesellschaft zur Verteidigung verurteilter Wirtschaftsleute und wirtschaftlicher Freiheiten“.
Sokirko stellte von 1966 bis 1990 zusammen mit seiner Frau Lidija Tkatschenko Filme aus Dias zusammen, die sie gemacht hatten. Das ist jetzt auch unser Thema: diese „Dia-Filme“, wie die beiden sie nannten.
Was ist ein Dia-Film? Es ist, was wir heute eine Präsentation nennen würden. Er bestand meist aus 100, 200, mitunter auch aus 400 Bildern. Die Vorführung dieser Filme wurde von Musik und Texten begleitet, die auf Tonband aufgezeichnet waren.
Lidija Tkatschenko, Sokirkos Frau, erinnert sich: „Dia-Filme mit Tonbegleitung herzustellen, das hat uns Slawa Korenkow beigebracht, ein Mitarbeiter und ehemaliger Kommilitone von Viktor. Er hatte im Herbst 1966 in der Röhrenfabrik seinen Film über den Sommerurlaub einiger Leute aus der Fabrik vorgeführt. Wir waren begeistert von dieser Kombination aus Farbe und Ton, Farbtönen und Musik, visueller und textueller Information, die er geschaffen hatte. Wir übernahmen das sofort, soweit wir das konnten, und es entstand der Dia-Film ‚Frühling des Lichts‘. Da geht es um die ewige Natur, Licht im Januar und um Freunde. Wir lernten dabei, mit einer eigenen Sprache zu sprechen und stützten uns auf Michail Prischwin und [andere] russische Dichter. Neben dem Hauptthema, der fast schon religiösen Huldigung der Natur, gibt es in ‚Frühling des Lichts‘ auch Nebenthemen, aus denen wir später eigene Themen machten. Eines ist kirchlich. Im gleichen Jahr noch begannen wir, systematisch Moskauer Kirchen zu fotografieren.
Mehrere Hundert Menschen haben unsere ‚Moskauer Kirchen‘ gesehen (so hieß der Film): bei uns zu Hause, bei anderen zu Hause, in der Röhrenfabrik und in verschiedenen Clubs sowie in Schulen und Hochschulen. Auch im Institut für Geschichte und Archivwesen.“

Insgesamt wurden 108 dieser Dia-Filme zusammengestellt. Was waren das für Filme? Noch einmal aus den Erinnerungen von Lidija Tkatschenko: „Es waren vor allem Dias von Reisen durch unser Land, in Kartonrähmchen und nach den Vorgaben des Drehbuchs angeordnet…“
Diese Dias, das will ich hier sofort sagen, befinden sich nicht im Archiv der Forschungsstelle Osteuropa [an der Universität Bremen]. Es gibt dort lediglich einen Band mit Texten: Drehbücher, Erläuterungen, Kommentare und Aufzeichnungen von Diskussionen zu diesen Filmen.
Jetzt aber weiter aus Tkatschenkos Erinnerungen: „Das Drehbuch wurde in der Regel von Witja [Viktor Sokirko] geschrieben, und wir haben es dann zusammen weiterentwickelt, zu einem klaren Gedanken, zu einer wirklich wahrhaftigen Darstellung des Geschehens und der eigenen Haltung dazu. Und es sollte rein sein, frei von überflüssigen Themen.“
Die Drehbücher wurden kopiert und in Bänden gesammelt. Es sind maschinengeschriebene Kopien, die in Kaliko- oder kartonierte Einbände gefasst wurden, welche oft irgendeiner technischen Dokumentation entnommen worden waren und wiederverwertet wurden. Dann wären da schließlich die technischen Mittel: Diaprojektor, Tonbandgerät und die Hände, die die Dias, dem Text folgend, wechselten.

Nun zu einigen Typen und Beispielen dieser Dia-Filme. Zum einen waren das historisch-landeskundliche Filme, angefangen bei jenem über die Moskauer Kirchen bis hin zu anderen über verschiedene Regionen der Sowjetunion. Die Filme sind in Serien unterteilt.
In der Serie „Russland“ wurden die Filme „Moskau — Opolje — Wolga“, „Altai — Sibirien“, „Nordosten“ (also Kischi, Solowki, Onega, die Gegend um Wologda) und „Nordwesten“ (also Nowgorod, Pskow, das Baltikum und Leningrad) zusammengefasst.
In der Serie „Randgebiete“ gibt es Filme über Zentralasien, den Kaukasus und so weiter. Zu dieser zweiten Gruppe könnte man auch die Filme über touristische oder Schiffsreisen zählen, die Sokirko, Tkatschenko und ihre Freunde unternahmen. 1981 entstand der Film „Das Schwarze Meer“, 1984 das „Pamir-Tagebuch“, 1985 das „Südrussische Tagebuch“ und 1986 das „Tagebuch Ural und Kaukasus“.
Die Sowjetunion war ein sehr geschlossenes Land. Auszureisen war extrem schwierig. Aber die gesamte übrige zugängliche, sichtbare und sich entfaltende Welt innerhalb der Landesgrenzen wurde von den Menschen bereist und studiert.
Es gab auch Filme über Eltern, Verwandte und Kinder. Einer der wichtigsten dieser Filme, zu dem sich tatsächlich Material in unserem Archiv befindet, ist „In Erinnerung an Mama“, ein Film über Tatjana Globenko, Sokirkos Mutter: „Ihren lieben Enkeln und meinen Kindern gewidmet: Artjom, Galja, Aljoscha und Anja Sokirko.“

Warum wurde das alles gemacht? Wie beschreiben die Schöpfer dieser Filme die Ziele ihrer Arbeit?
Viktor Sokirko schrieb über die Dia-Filme, sie seien „nicht nur zu einem bloßen Hobby, sondern zur wichtigsten Art unserer Erschließung der Welt“ geworden. Seine Frau pflichtet ihm bei: „Wir haben eine unserer Bestimmungen im Leben erfüllt, nämlich die Erinnerung an unsere Zeit zu bewahren und künftigen Historikern unsere lebendigen, unzensierten Gedanken und Gefühle zu schenken, und die unserer Freunde und Bekannten.“
Mir scheint, hinter dieser Methode der Erschließung, des Erfahrens, des Verstehens der Welt steht eine riesige Liebe und Dankbarkeit für diese Welt. Es ist unglaublich schön, dass sich diese Menschen in ihren so beschränkten Grenzen, in einem so eng gesteckten Rahmen und mit ihren finanziell, zeitlich und psychologisch sehr begrenzten Möglichkeiten so verhielten. Sie haben ihr Möglichstes getan, um die Welt festzuhalten, die sie sahen, eine Welt mit einer sehr reichen Geschichte — und eine Welt, die dadurch einen ganz aktuellen, synchronen Abdruck erhielt.
Es ist unbedingt zu erwähnen, dass über diese Filme diskutiert wurde. An Freitagen versammelten sich in der Wohnung von Sokirko Gäste, mal zehn, mal zwanzig, mal dreißig… im Höchstfall vielleicht vierzig. In der Saison 1981/82 zählte Sokirko insgesamt 109 Teilnehmer bei diesen Treffen. Erst wurde ein Film gezeigt, dann gab es eine Diskussion, die aufgezeichnet wurde.
Sokirko hielt dabei fest, wer an den Diskussionen teilnahm und welchen Beruf sowie welchen Bildungsstand die Gäste hatten. Diese Diskussionen sind ebenfalls ein Dokument jener Ära. Für Sokirko war es wichtig, nicht nur verschiedene Gedanken und Ideen festzuhalten, die bei den Diskussionen ausgetauscht wurden. Er wollte sie auch ihrer sozialen Herkunft, dem sozialen Status der Person zuordnen, die diese Gedanken äußerte. Wir können also diese Aufzeichnungen als eine Art soziale Anthropologie jener Zeit betrachten.
Die Themen der Filme wurden in den Diskussionen mit allgemeineren Fragen verknüpft, in denen es um Philosophie, Kultur und Geschichte ging.
In dem Band, in dem die Stenogramme der Diskussionen gesammelt wurden, finden wir unter anderem folgende Themen: „Altai (warum ziehen wir in die Berge?)“, „Tian Shan (Sinnfragen zu den Werken Aitmatows)“, „Sibirien — Burjatien (Was uns der Buddhismus gibt)“, „Estland, Lettland und das sterbende Königsberg (Europa und Russland, Katholizismus)“, „Moskauer Kirchen (Unsere orthodoxen Ursprünge)“, „Onega, Solowki (Schlüsselfrage: Ist Orthodoxie Autokratie oder Volkstümlichkeit?)“.

Zu jedem Film wurden für die Diskussion vorab Fragen formuliert. Für den Dia-Film „Altai“ etwa wurde als Thema „Sinn und Philosophie des Alpinismus“ genannt; die Fragen lauteten:
1) Gibt es eine Verbindung zwischen den Gipfeln der Berge und geistigen Höhenflügen?2) Kann man der Natur als Unendlichkeit, als Gottheit huldigen oder sollte eine solche Verehrung als Götzendienerei betrachtet werden? Haltung zum Pantheismus.3) Was war im Film verstörend? Persönliche Eindrücke.4) Bergwandern als Lebensmodell — mit seinen Idealen und Utopien und im Gegensatz zur Sattheit und Wärme der Täler. Bergwandern als System von Entbehrungen und Lehren fürs Leben.
Unter den Teilnehmern der Diskussionen hob Sokirko weniger deren individuelle Ansätze hervor als vielmehr die historischen Typen. Beispielsweise: orthodoxer Potschwennik [in etwa: „Volks- und Bodenverbundener“], Westler, marxistischer Patriot.
Lidija Tkatschenko erinnerte sich: „Unsere Freunde und Bekannten warteten schon auf neue Dia-Filme. Die alten wurden mehrfach angeschaut, und mal wurden unsere Entdeckungen und Einsichten angenommen, mal stritten sie heftig und verteidigten ihre eigenen Vorstellungen zum Diskussionsthema. Zufällige Gäste hörten den ungewohnten Redebeiträgen verwundert zu und unterbreiteten mitunter ihre eigenen Gedanken, damit die anderen sie erörtern könnten.“
Abschließend noch einige Worte zur Bedeutung dieser Filme. In erster Linie sind es historische Exkurse in die Vergangenheit praktisch sämtlicher Regionen der Sowjetunion. Diese Filme bieten ein kulturelles, ethnografisches, naturbezogenes Panorama des Lebens in diesem riesigen Land. Sie sind von einem Narrativ des Erkennens, Erforschens und Verstehens durchzogen. Diese Begriffe sind denn auch der Schlüssel zum gesamten Wirken von Sokirko. Den Band, in dem die Stenogramme und Analysen der Abende gesammelt wurden, bezeichnete Sokirko als „Erörterung der Dia-Filme um eines gegenseitigen Verstehens willen“.
Es geht um eine Strategie des persönlichen Verhaltens unter eingeschränkten Möglichkeiten, ein Bestreben, die ganze Komplexität einer sehr reichen, sehr großen Welt zu verstehen, und zwar: dies selbst zu verstehen, es mit Freunden zu erörtern, es den Kindern zu hinterlassen. Das ist, scheint mir, sehr, sehr wichtig.
Ich denke, dieses Material wartet dringend auf seine Erforschung, seine Historiker, seine Herausgeber.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Wie Nikolai Glaskow einen legendären Begriff für unzensierte Literatur erfand, was der Vorläufer des Samisdat war und was Wenedikt Jerofejew und Andrej Tarkowski damit zu tun haben.

Dechiffrierung
Hier geht es um die Sammlung des Samisdat der 1940er bis 1970er Jahre, die der Literaturwissenschaftler, Historiker und Bibliograf Juri Abysow angelegt hat.
Einige Worte über ihn: Abysow wurde 1921 im Ural geboren, in der Kleinstadt Resh. 1940 wurde er in die Armee eingezogen, kämpfte an der Südwestfront und wurde bei Charkiw schwer verwundet. Er kehrte dann in seine Heimat zurück und schrieb sich an der Universität Swerdlowsk ein. 1946 wechselte er zur Lettischen Universität, schloss 1949 sein Studium ab und lebte weiter in Riga. Er unterrichtete am Rigaer Pädagogischen Institut, übersetzte viel aus dem Englischen, Polnischen und Lettischen. Von 1989 bis 2006 war er Vorsitzender der „Lettländischen Gesellschaft für russische Kultur“. Viele Jahre seines Lebens beschäftigte er sich mit der Erstellung einer Bibliografie der russischen Emigrantenpresse.
Seine Sammlung umfasst selbstgefertigte Lyrikbände von Anna Achmatowa, Nikolai Gumiljow, Anatoli Marijengof, Igor Sewerjanin, Marina Zwetajewa und Wadim Scherschenewitsch. Die ersten dieser Bücher waren Mitte und Ende der 1940er Jahre angefertigt worden, als sich an der Universität Swerdlowsk eine Gruppe junger Leute zusammenfand, die sich für Poesie begeisterten. Zu den wertvollsten Teilen in den Beständen Abysows gehört eine Sammlung zum Proto-Samisdat.

Was ist der Proto-Samisdat? Allgemein wird angenommen, dass der Samisdat während der Tauwetter-Periode [ab 1953, nach dem Tod Stalins] entstand. Aber bereits etliche Zeit vor dem Samisdat des Tauwetters gab es die Idee, Bücher selbst herzustellen, zum eigenen Vergnügen, um sie gemeinsam im Freundeskreis zu lesen… also die Idee unzensierter Literatur. Ausgaben dieser Art aus den 1920er bis 1940er Jahren werden daher als Proto-Samisdat bezeichnet. Und Abysows Sammlung ist ein sehr bemerkenswertes Beispiel für Literatur dieser Art.
Wie ist sie entstanden? Juri Abysow studierte von 1943 bis 1946 an der Universität Swerdlowsk. Zu seinen Dozenten gehörte der Dichter und Übersetzer Daniil Gorfinkel aus der Dichtervereinigung „Klingende Muschel“. Sein Englischdozent und gleichzeitig einer seiner Freunde war Lew Chwostenko, ein Übersetzer und Literaturhistoriker und Vater des bekannten Dichters Alexej Chwostenko (genannt „Chwost“). Zu diesem Kreis gehörte auch Viktor Rutminski.
Gemeinsam organisierten sie den unzensierten und natürlich inoffiziellen Eigenverlag „Stilos“, der Werke von Dichtern kopierte, die sich nicht in den sowjetischen Kanon fügten. Hinzu kamen eigene Gedichte und Verse. Alles begann also wohl mit eigenen literarischen Versuchen.
Später kopierten sie von Hand Werke von Dichterinnen und Dichtern des Silbernen Zeitalters der russischen Literatur [etwa 1890 bis 1930] und banden sie zu Büchern. Es waren Werke, die sie zufällig in die Hände bekamen und zur Lektüre sowie als Erinnerung behielten. Etwa einen 1920 in Odessa erschienenen Sammelband von Wladimir Narbut. Es gibt auch einen Band mit ausgewählten Gedichten von Nikolai Gumiljow sowie ein Büchlein von Anatoli Marijengof.
Ja, Ende der 1940er Jahre wurden Bücher noch von Hand kopiert.
Die ersten Bücher aus Abysows Sammlung, die auf der Maschine geschrieben wurden, stammen aus dem Jahr 1953. Das sind Bändchen mit gesammelten Gedichten von Nikolai Glaskow. Von ihnen wird später die Rede sein.
Besonders schön sind die Büchlein, die Margarita Stepanowa von Hand anfertigte. Sie war wohl auch eine Studentin der Universität in Swerdlowsk und gehörte zu jenem Literaturzirkel. Eins davon ist eine genaue, handgeschriebene Buchkopie mit Zeichnungen, Grafiken, Vignetten, Verlagssiegel, Inhaltsverzeichnis, Kennzeichnung der Seiten und einer genauen Platzierung der Texte auf den Seiten.
Swerdlowsk war natürlich nicht das einzige Zentrum des Proto-Samisdat in der Sowjetunion. Aber dank der agilen Tätigkeit von Abysow – und weil Gabriel Superfin Abysows Archiv der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen zur Aufbewahrung übergab — ist diese Sammlung heute eine der umfassendsten und kostbarsten ihrer Art.
Nicht nur der Proto-Samisdat, sondern auch die Frühphase des eigentlichen Samisdat sind in dieser Sammlung reichhaltig vertreten. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Lyrikbände von Nikolai Glaskow, der erst in den 1960er Jahren offiziell [als Dichter] anerkannt wurde. Abysows Sammlung umfasst den ersten, dritten, fünften und achten der Gedichtbände Glaskows, die 1953–1955 entstanden. Daneben enthält die Sammlung zwei weitere Sammelbände mit Gedichten und Poemen.
Für die Literaturgeschichte ist Glaskow nicht nur durch seine künstlerische Handschrift von Bedeutung, sondern auch, weil auf den Umschlägen seiner Bücher das fiktive Verlagssiegel „Samsebja-Isdat“ prangte.
Hier finden sich die Anfänge des später weit verbreiteten Begriffs „Samisdat“.
Nikolai Glaskow schrieb seit 1932 Gedichte. Ab 1938 studierte er am Moskauer Pädagogischen Institut. 1939 begründete er zusammen mit [dem Dichter] Julian Dolgin die neofuturistische Literaturbewegung „Nebywalism“. Er veröffentlichte zwei Almanache. Dafür – oder wegen der Repressionen gegen seinen Vater oder wegen beidem – wurde er vom Institut ausgeschlossen. 1940 schrieb er sich am Literaturinstitut ein, wo er mit Michail Kultschizki, Dawid Samoilow, Boris Sluzki, Sergej Narowtschatow und Pawel Kogan in einem Studienjahr war. Sie repräsentierten die Dichtergeneration der Kriegszeit. Glaskow wurde aus gesundheitlichen Gründen nicht in die Armee eingezogen, denn er hatte psychische Störungen. Er zog also nicht in den Krieg. Bereits die frühen Gedichte Glaskows aus der zweiten Hälfte der 1930er Jahre sind sehr beeindruckend.
Man hat den Eindruck, [der bekannte russische Schriftsteller] Wenedikt Jerofejew [1938–1990] hätte sie geschrieben — wenn er denn in den 1930er Jahren Gedichte geschrieben hätte:
freie Form, umgangssprachliche Intonation, Wortspiele, Ironie, Schauspielerisches, Selbstironie und Selbstreflexion.
Glaskows Gedichte werden hier in wörtlicher Übersetzung wiedergegeben.
Ich gehe auf der Straße,Die Welt vor Augen,Die Worte reimen sichGanz von allein.
(1939)
Dem Trunkenen ist wohl.Der Trunkene ist wahnsinnig klug.Der Trunkene sucht keine Wege,Seine Beine führen ihn selbst.Kommende Zeiten allerdingsHab ich noch nicht erdacht.Sage aber als Prophet, Die Menschen, die sind einsam.
Glaskows Poesie zeichnet sich durch ihren aphorismenartigen Charakter, ihre starke literarische Grundlage sowie eine erstaunliche Freiheit von Wort und Form aus.
Geschrieben 1941:
Ich brauche eine zweite Welt,Eine riesige, wie Widersinn, Die erste Welt schimmert am Horizont, ohne zu locken.
Fort mit ihr, fort:In ihr warten Leute auf den Trolleybus, In der zweiten aber — auf mich.
Zur Frage der dichterischen Tradition:
Welimir [Chlebnikow] war nicht von [dieser] Welt,Aber er öffnete mir die Türen zur Welt.
1942, mitten im Krieg:
Riesige Stadt. Verdunklung.Ich wandele. Schaue hierhin und dorthin.Unter allen meinen bist du die meinste —Und das für immer!
Sobald wir uns treffen, und bleiben,Damit es schön sei zu zweit,Wir werden uns nicht trennen, nicht ergrauen,Und nicht sterben!
Verse von 1944:
Ich lebe, ohne Gedichte zu veröffentlichen,Schaffe dafür Poesie.Unwichtig, wie ich verfahre,Wichtig aber, dass ich spreche.
Was ich sage, über das verfüge ich,Ich hab’s nicht eilig mit Veröffentlichung.Ganz gleich, was ich da von mir gebe,Wichtig ist, was ich schreibe.
Ich schreibe, dass ein neues Leben anbricht, Ein wirklich Poetograder [Leben].Ganz gleich, was ich verfasse,Wichtig ist, wie ich lebe.
Unwichtig, dass der Dichter betrogen wurdeVon den mit dem Neuen nicht Einverstandenen,Wichtig aber, dass man seiner gedenktMit dem großartigen, guten Wort.
Mich wird man anerkennen, da bin ich überzeugt.Früher als in zweihundert Jahren,Und [dann] wird zur besten aller TavernenDie Glaskow’sche Universität.
Alle, die [den Regisseur Andrej] Tarkowski lieben, werden Glaskow auch durch seine Rolle des Fliegenden kennen, am Anfang [des Films] „Andrej Rubljow“.
Unerträgliche Lebensbedingungen, Obdachlosigkeit und späte Anerkennung — all das hat es in seinem Leben gegeben.
In einem der Bändchen mit Gedichten von ihm gibt es eine vierzeilige Widmung, die man als Motto für die gesamte sowjetische Geschichte auffassen kann:
Ich schaue auf die Welt von unter dem TischDas zwanzigste Jahrhundert, ein außerordentliches.Je interessanter das Jahrhundert für den Historiker,Desto trauriger für den Zeitgenossen!
Ein ganz außerordentlicher Dichter.
Unser Archiv ist kostbar, weil es maschinengeschriebene Gedichtbände von Nikolai Glaskow umfasst, auf deren Umschlag in der Regel das Jahr (meist 1953) steht — und das fiktive Verlagssiegel „Samsebja-Isdat“.

От которой, собственно, и получило распространение понятие «самиздат».
Николай Иванович Глазков писал стихи с 1932 года. С 1938 года учился в Московском педагогическом институте. В 1939-м вместе с Юлианом Долгиным основал неофутуристическое литературное движение «Небывализм». Выпустил два литературных альманаха. За это — или за то, что его отец был репрессирован, или за то и другое — Глазкова отчислили из института. В 1940 году он поступил в Литературный институт, где его сокурсниками были Михаил Кульчицкий, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Сергей Наровчатов, Павел Коган. То есть поколение поэтов военного времени. Сам Глазков в армию не призывался по болезни, по расстройству психики, и в войне не участвовал.
Уже ранние стихи Глазкова второй половины 1930-х годов поражают.
Свободная форма, разговорные интонации, каламбуры, ирония, актерство, самоирония и саморефлексия.
Я иду по улице,
Мир перед глазами,
И слова рифмуются
Совершенно сами.
(1939 год)
Пьяному быть хорошо.
Пьяный безумьем умен.
Пьяный не ищет дорог,
Сами ведут его ноги.
Правда, грядущих времен
Я не придумал еще.
Но говорю как пророк,
Люди, они одиноки.
Поэзии Глазкова свойственны афористичность, сильное лирическое начало, удивительная свобода слова и формы.
В 41-м году написано:
Мне нужен мир второй,
Огромный, как нелепость,
А первый мир маячит, не маня.
Долой его, долой:
В нем люди ждут троллейбуса,
А во втором — меня.
К вопросу о поэтической традиции:
Был не от мира Велимир,
Но он открыл мне двери в мир.
1942 год, война на дворе:
Огромный город. Затемнение.
Брожу. Гляжу туда, сюда.
Из всех моих ты всех мойнее —
И навсегда!
Как только встретимся, останемся,
Чтоб было хорошо вдвоем,
И не расстанемся, и не состаримся,
И не умрем!
А вот стихи 1944 года:
Живу, стихов не издавая,
Зато поэзию творю.
Неважно, как я поступаю,
А важно, что я говорю.
Что говорю, тем обладаю,
А издаваться не спешу.
Неважно, что я там болтаю,
А важно то, что я пишу.
Пишу, что станет жизнь иная,
Поэтоградной наяву.
Неважно, что я сочиняю,
А важно то, как я живу.
Неважно, что поэт обманут
Не согласившимися с новым,
А важно, что его помянут
Великолепным добрым словом.
Меня признают, я уверен,
Раньше, чем через двести лет,
И будет лучшей из таверен
Глазковский университет.
Современнику, любящему Тарковского, Глазков известен по роли летающего мужика в начале «Андрея Рублева».
И безбытность, и бездомность, и позднее признание — все было в этой судьбе. В один из томиков его собрания стихов вложен его автограф-четверостишие, которое может считаться эпиграфом ко всей советской истории:
Я на мир взираю из-под столика:
Век двадцатый — век необычайный.
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней!
Удивительный совершенно поэт.
Драгоценность нашего архива в том, что в нем хранятся машинописные сборники стихов Николая Глазкова, на титульном листе каждого из которых написано: год (как правило, 1953-й), и фиктивная издательская марка: «Самсебяиздат».
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department


